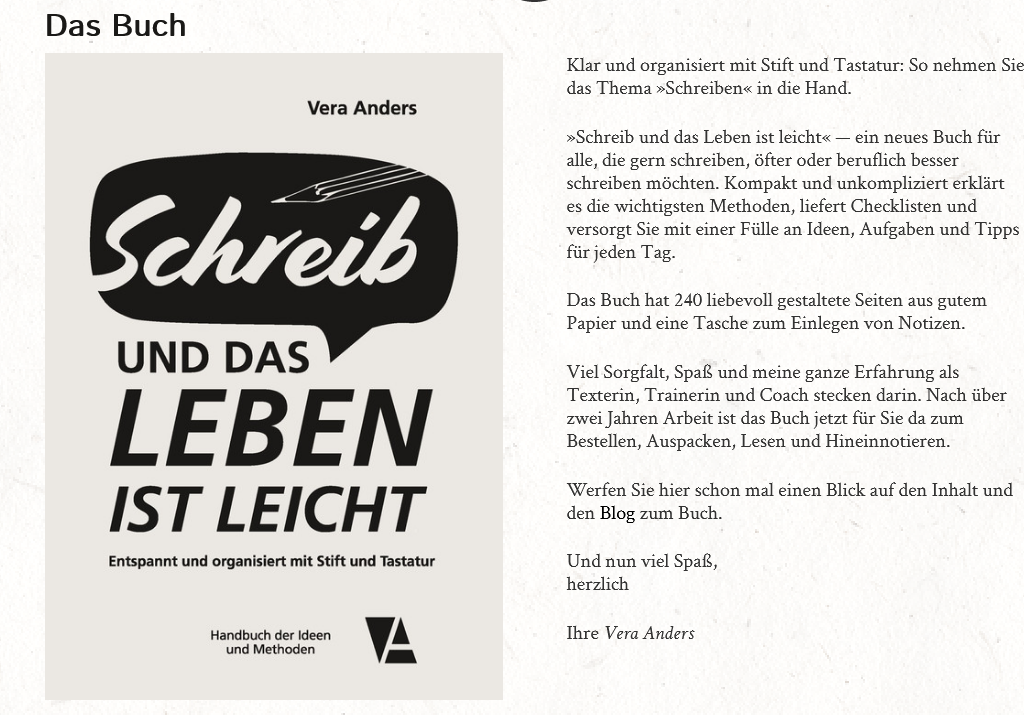
Es gibt Ratgeberbücher, die vergisst man, kaum, dass man sie aus der Hand gelegt hat, und es gibt Bücher, die schmeicheln sich in die Hand ein und verändern den Alltag. Vera Anders‘ Schreib-und Ideenhandbuch „Schreib und das Leben ist leicht“, gehört zur zweiten, der wirksamen Sorte. Schon die Buchstaben „Schreib“ auf dem Cover sind erhaben und verleiten dazu, sie mit dem Finger nachzufahren.
- Kaufen Sie das Buch! Es lohnt sich! https://schreib-leicht.de/
Schlägt man das 263 Seiten starke „Handbuch der Ideen und Methoden“ auf, strahlen einem Klarheit und Aufgeräumtheit entgegen. Das entspricht seinem Anliegen, Nutzern und Nutzerinnen zu helfen, schreibend ihr Leben, ihre Jobs und sonstigen Herausforderungen besser zu meistern.
Während ich diese Rezension verfasse, tickt neben mir eine kitschige, eiförmige Eieruhr aus Bambus. Sie ist eingestellt auf 15 Minuten – das ist laut Vera Anders die Zeitspanne, die sich jeder Mensch am Stück konzentrieren kann und sollte, um wirklich was geschafft zu kriegen. Das heißt, während das Bambusei eifrig vor sich hintickt, sind Ablenkungen tabu. Ob ich dank dieses Tipps aus „Schreib und as Leben ist leicht“ nun in der Summe effektiver geworden bin, habe ich nicht erfasst. Aber dass leise rappelnde Eierührchen erinnert mich ein bisschen an mein Metronom auf dem Klavier – es rhythmisiert das Schreiben, und während die Eieruhrzeit läuft, schreibe ich eben. Und fünfzehn Minuten sind eine überschaubare und vor allem gut erträgliche Zeitspanne. Ist diese vorbei, kann ich was anders machen oder die 15 Minuten von neuem laufen lassen.

Mehrwert für Schreibprofis der rechtsberatenden Zunft
Können auch Personen, deren Handwerkszeug das Schreiben ist, aus diesem Buch etwas mitnehmen? Ja. Wer beruflich schreiben muss, aber das Schreiben als „Muss“ empfindet, erhält hier jede Menge Tipps, sich das Schreiben als etwas in jeder Hinsicht Bereicherndes zu erschließen – von der Ideenfindung bis zur Konfliktlösung, zum Entspannen, zum Laune verbessern und zu Vielem mehr.
„Schreib und das Leben ist leicht“ steckt voller probater Ideen und Methoden. Man merkt dem sorgsam konzipierten und komponierten Handbuch an, dass seine Autorin hier die Essenz aus jahrzehntelangem Schreib- und Lebenscoaching kondensiert hat – und das Ganze mit eigener Lust am Schreiben und Ausprobieren gewürzt hat.
Das Handbuch unterteilt sich in drei große Teile –
- erstens dem Start ins Schreiben und gewissermaßen der Basics für gutes Schreiben.
- Zweitens dem jobmäßigen Schreiben und
- drittens dem Schreiben für eigene Zwecke – von der Selbstorganisation über die Konfliktbearbeitung bis hin zum Reise- oder Traumtagebuch.
Putz dir die Zähne und das Schreiben wird leicht
Den Auftakt machen Empfehlungen zur Schreib-Location. Es liest sich angenehm weg, wie man sich selbst in Schreiblaune bringen kann – auch, wenn man eigentlich lieber was anderes machen möchte. Natürlich ist es absolut logisch, es sich hübsch zu machen, wenn man schon schreiben muss. Und sinnvoll ist es auch, vor dem Schreiben Dinge zu tun, die den Kopf klar machen.
- Einen Tipp setze ich um, seit ich ihn bei Vera Anders gelesen habe: Ich putze mir die Zähne. Ob meine Texte mehr Biss haben, wenn auch die Sprechwerkzeuge poliert werden, mögen andere beurteilen.
Nach den Präliminarien folgen die Suche nach dem eigenen Stil („Passt der Text eher zu einer pragmatischen Sachbearbeiterin mit Vorliebe für Beige oder zu Ihnen und Ihrer schillernden Persönlichkeit?“). Und jede Menge schnell umsetzbare Tipps für anschaulicheres und verständlicheres Schreiben.
Feng Shui in Buchform
Ein Tipp, den man auch als geübte Schreiberin immer mal wieder anwenden sollte, lautet: „Mit einem Ziel schreiben“, sprich, vor dem Schreiben fragen „was will ich?“ und „wie nutzt das meiner Zielgruppe?“. Vera Anders empfiehlt außerdem sprachliches Feng-Shui.
„Wir brauchen dazu nicht mal eines dieser komplizierten Clearing-Rituale. Beherztes Kürzen reicht.“
Wer wissen will, wie sich Feng Shui in Buchform anfühlt, kaufe das Buch. Es setzt in Sachen Klarheit, Anschaulichkeit und Prägnanz im wesentlichen seine eigenen Tipps um.
Vor allem kommen all die Tipps so amüsant formuliert daher, dass man Lust bekommt, die eigenen Texte ein bisschen nachzuschleifen.
- Ein Tipp, den ich vorher noch nicht kannte, lautet zum Beispiel, sich die eigenen Texte mit der Word-Vorlesefunktion vorlesen zu lassen. Haben Sie noch nie ausprobiert? Dann los!
So weckst du die Kreativität in dir oder überwindest Schreibblockaden
Wenn einem nicht ganz klar ist, was man zu schreiben hat, oder wenn einen die Schreibblockade hemmt, helfen die zahlreichen Kreativmethoden. Wer etwa erfahren möchte, wie man den Ideengenerator mit einer MindMap zünden oder logische oder ulkige Zusammenhänge erkennen kann, lernt das hier. Wort-Cluster, Reizwörter oder Zettelkästen sind weitere der Methoden, mit denen Anders auch selbsternannten „Kreativversagern“ auf die Sprünge hilft.
Workout mit Word-outs
Das Handbuch lässt sich auch gut zum Selbsttraining verwenden. Die sogenannten Word-outs sind Workouts fürs Besserschreiben und bestehen aus Schreib-, Denk- und Abhakaufgaben für Tage, Wochen oder Monate.
Lieben Sie Ihre to-do-Liste oder ignorieren Sie sie
Mit großem Interesse habe ich den Orgateil gelesen, denn wie viele Selbstständige leide auch ich unter nie kürzer werdenden To-do-Listen. Neben Tipps für zahlreiche Listenvarianten und listige Listen gibt Vera Anders den Rat, es im Zweifelsfall mit Jonathan Swift zu halten. Der schrieb seine Vorsätze zwar auf, notierte aber als Zusatz: „Mir schwant: ich werde nicht eine befolgen.“
Strukturieren und Organisieren? You can and you will
Was die Textstruktur angeht, haben Anwältinnen und Anwälte dem gemeinen Volk insofern was voraus, als sie durch den Urteils- und Gutachtenstil eine Grundstruktur im Kopf haben.
Das hindert viele von ihnen bekanntermaßen nicht daran, überladene und unstrukturierte Bleiwüsten zu fabrizieren. „Schreib und das Leben ist leicht“ enthält für solche Fälle einen Strukturtest, mit dem man Satz für Satz oder Absatz für Absatz nachstrukturieren kann. Auch das für unerfahrene Schreibende leidige Thema der Übergänge wird behandelt. Für mich persönlich neu und hilfreich war die 15-Minuten-Eieruhrmethode, die ich wie eingangs beschrieben in mein Selbstorganisier-Repertoire aufgenommen habe.
Andere Methoden, die ausführlich beschrieben werden, sind Mood-Boards, Kanbans, Scetchnotes und andere. Auch hier folgt jedem Kapitel ein „Word-Out“ mit Trainingsaufgaben.
Schreiben denkt es sich leichter
Vera Anders wäre nicht Vollblut-Coachin, wenn sie nicht auch das Selbstmanagement in ihrem Schreib-Coaching-Ideen-Handbuch behandeln würde. Wie nimmt man sich Zeit? Wie schafft man Raum? Wie bleibt man am Ball? Den Antworten nähert sich das Buch mit Schreibaufgaben. Zum Beispiel kann man schreibend Ausreden identifzieren.
Übersetzt man zum Beispiel den Satz „Ich habe keine Zeit“ ehrlich, könnte er Vera Anders zufolge lauten: „Das ist leider nicht meine Priorität, und ich hoffe, dass Du mir und ich mir selbst abkaufe, dass ich dafür keine Minute aufwenden kann.“
Anders: „Kurz: Ob aufgeschrieben und bewusst oder unbewusst – Sie entscheiden, wem Sie Ihre Stunden oder Minuten widmen. Wenn Sie etwas wollen, finden Sie einen Weg und die Zeit dafür; wenn Sie etwas nicht wollen, einen Grund, es nicht zu tun.“
Vera Anders, Autorin von „Schreib und das Leben wird leicht“

Die Formel für die wahre Motivation
Etwas Originelles liefert das Schreib-und-Ideen-Handbuch im Orgakapitel: eine Formel, um die Motivation zu berechnen und hernach zu verbessern. Wenn Sie wissen wollen, welches Ihrer diversen Projekte die Chance hat, tatsächlich verwirklicht zu werden, kann das helfen. Haben Sie überhaupt Bock, Ihr Schreiben zu verbessern und all die Ziele zu erreichen? Wenn das Ziel grundsätzlich erreichbar ist, aber noch Hindernisse vorhanden ist, wissen Sie, welche Faktoren Sie verändern müssen, um möglichst nahe an die „wahre, höchstmögliche Motivation“ heran zu kommen.
Schreiben für andere – und besser verkaufen
Der Buchteil, der das Schreiben für andere betrifft, enthält Profitipps und Übungen, um Anschreiben, Werbe- und Pressetexte, Webtexte und Berichte pointierter und prägnanter zu formulieren. Wie konzentriert man sich auf das Wesentliche bei Berichten und Zusammenfassungen?
Sagenhaft unterschätzt wird seit jeher das Protokoll. Wenn Sie in Gremien Einfluss nehmen wollen, sollten Sie das Protokoll übernehmen. Hier erhalten Sie die besten Tricks, wie Sie das souverän hinbekommen.
Schreibratgeber enthält auch belletristische Tipps
Gar nicht so wenige Menschen, die mit Recht zu tun haben, bekommen im Laufe ihres Lebens irgendwann Lust, selbst jenseits der Fachliteratur literarisch zu schreiben. Umgekehrt etliche große Schriftstellerinnen und Schriftsteller irgendwann mal Jura studiert oder praktiziert. Die Tipps, die Vera Anders kompakt zusammenfasst, lassen sich auch für weitere Texte nutzen, bei denen es aufs Storytelling ankommt. Zum Beispiel, wenn Sie Anekdoten erzählen, um Geschäftspartner zu unterhalten, wenn Sie für die Presse schreiben, wenn Sie Schriftsätze so fomulieren, dass man Ihrem Anliegen Gehör schenkt. Und so weiter.
Schreibe für dich selbst und werde glücklich
Das Kapitel zum belletristischen Schreiben leitet über zum dritten und letzten Teil des Buches – dem Schreiben für sich selbst. Hier merkt man dem Buch an, wie sehr die Autorin das Schreiben liebt und selbst Schreiben offensichtlich in allen Varianten einsetzt, um mit sich selbst, ihren Mitmenschen und dem Leben im Allgemeinen besser zu Rande zu kommen.
Hier finden sich Schreibtipps gegen hängende Mundwinkel (hätte mal Angela Merkel das Buch gelesen!). Oder schreiberische Fastentipps für die Zeit nach Aschermittwoch, mit denen man auch vollgestopfte Regale entmüllen kann. Es gibt auch Formuliertipps für einen “Vertrag mit sich selbst“. Ob der auch bei hartnäckiger Süßigkeitensucht Abhilfe schafft, habe ich noch nicht ausprobiert.
Glückstagebücher und Talentscouting
Schreibend, zeichnend, Klebestreifen aufklebend – die Schreibübungen, mit denen man diversen Erkenntnissen auf die Schliche kommt, sind inspirierend und witzig. Am Ende steht immer ein Zuwachs an Selbsterkenntnis. Selbst für das Anfertigen eines Traumtagebuchs gibt es altbekannte, aber auch neue und originelle Tipps. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass es hilft, einen Zettel, Stift oder tatsächlich ein kleines Büchlein unmittelbar neben dem Bett liegen zu haben. Schon Ideen sind hochgradig flüchtig, aber Träume verfliegen, ehe man begriffen hat, dass sie da waren. Gewöhnt man sich hingegen an, noch im Halbschlaf zu Stift und Büchlein zu greifen, gelingt es, manche Traumereignisse festzuhalten. Dann kann man sie tagsüber zur Inspiration oder auch zum Durchdenken von Problemen nutzen. Noch nicht gelungen ist es mir, mich bis zum luziden Träumen hochzuarbeiten. Das sind Träume, in denen man, obwohl schlafend, den Traum oder wie Anders sagt, „das Drehbuch“ ändert.
Ziele finden, verfolgen und glücklich sein – das Schreiben hilft dabei
Letztlich sind es die Ziele, die uns zu etwas hinziehen. Nach der Lektüre von Vera Anders‘ Buch hat man eine ganze Palette mehr Ideen im Gepäck, um Ziele zu identifizieren und sie mithilfe des Schreibens besser zu erreichen. Und selbst wenn man mit dem Buch keinerlei konkrete Ziele verfolgt, sondern einfach nur die ein oder andere Übung ausprobiert, hat man zumindest eins: Viel Spaß.
Fazit: Unbedingt lesen und inspirieren lassen. Hilft beruflichen Vielschreibern ebenso wie Personen, die noch dabei sind, sich schreiberisch zu entwickeln oder erst einmal ausprobieren wollen, was sie schreibend alles erreichen können.
Schreib und das Leben ist leicht: Entspannt und organisiert mit Stift und Tastatur, Handbuch der Ideen und Methoden Taschenbuch – 5. Januar 2020 von Vera Anders, Taschenbuch 15,88 €, ISBN 978-3000636653
- So kommen Sie schneller zum Buch beim großen A: https://www.amazon.de/Schreib-das-Leben-ist-leicht/dp/300063665X
- Hier die Bestellung und weitere Tipps über die Buchwebsite: https://schreib-leicht.de/

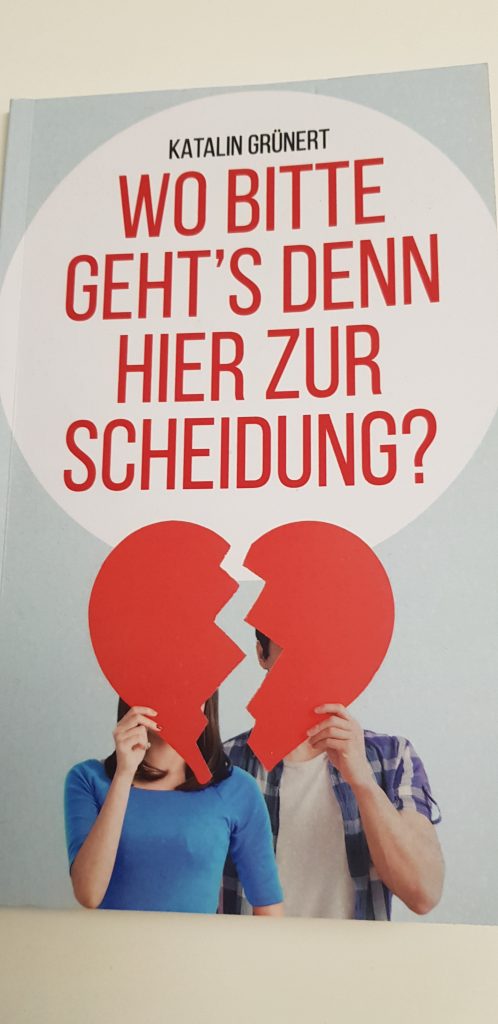

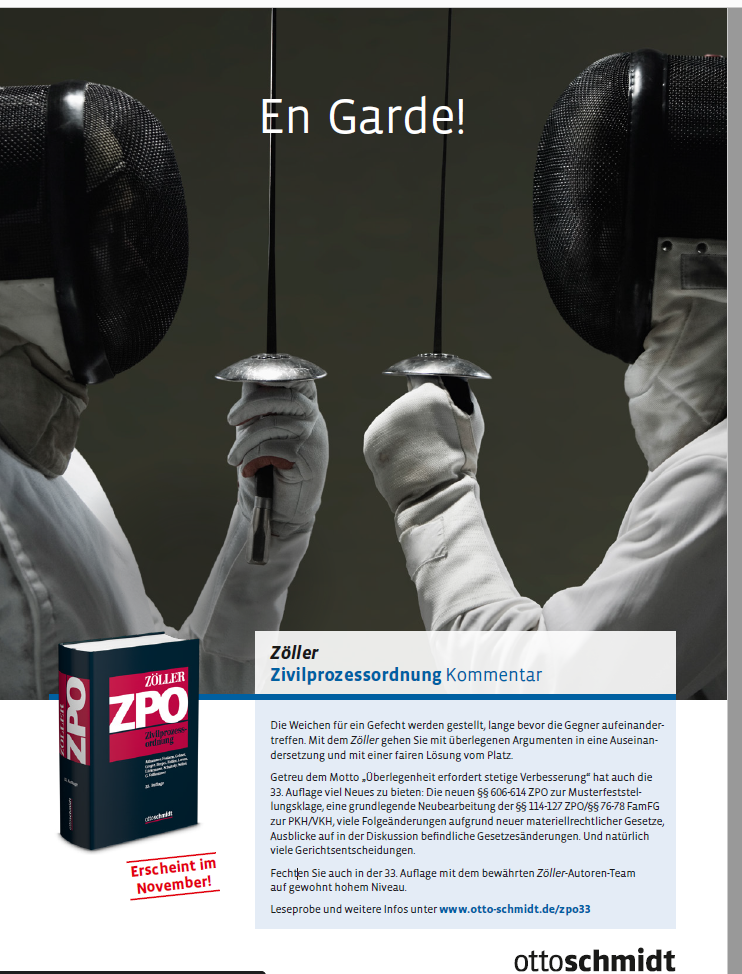



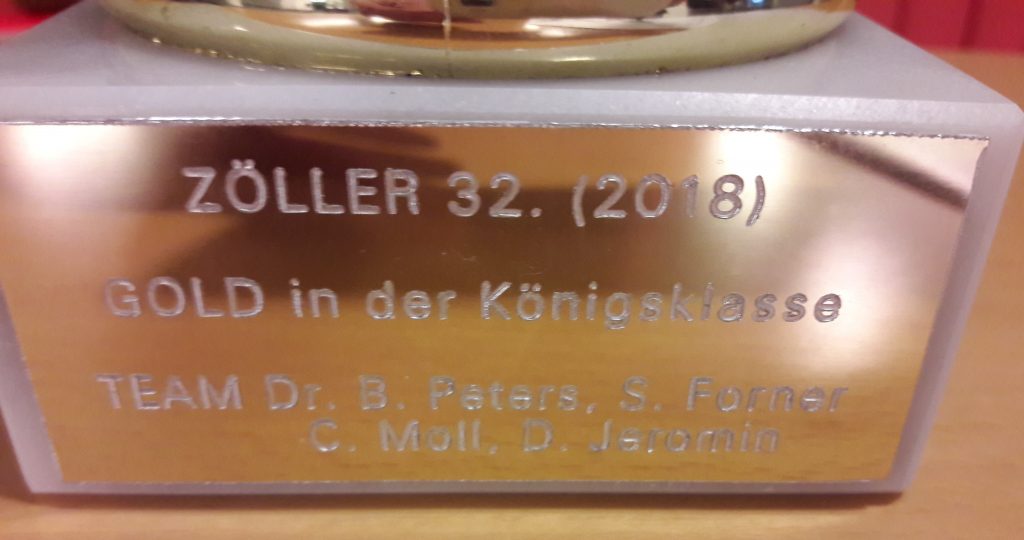

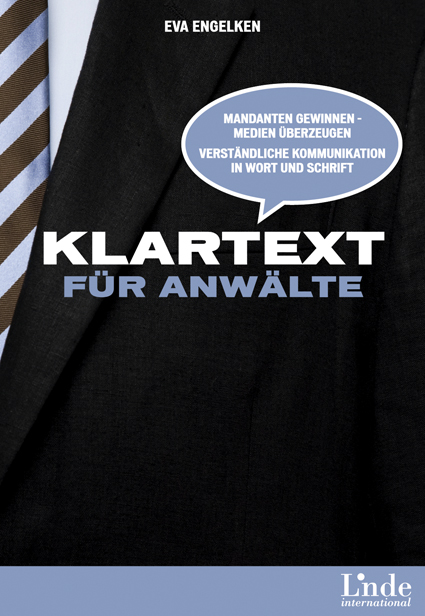

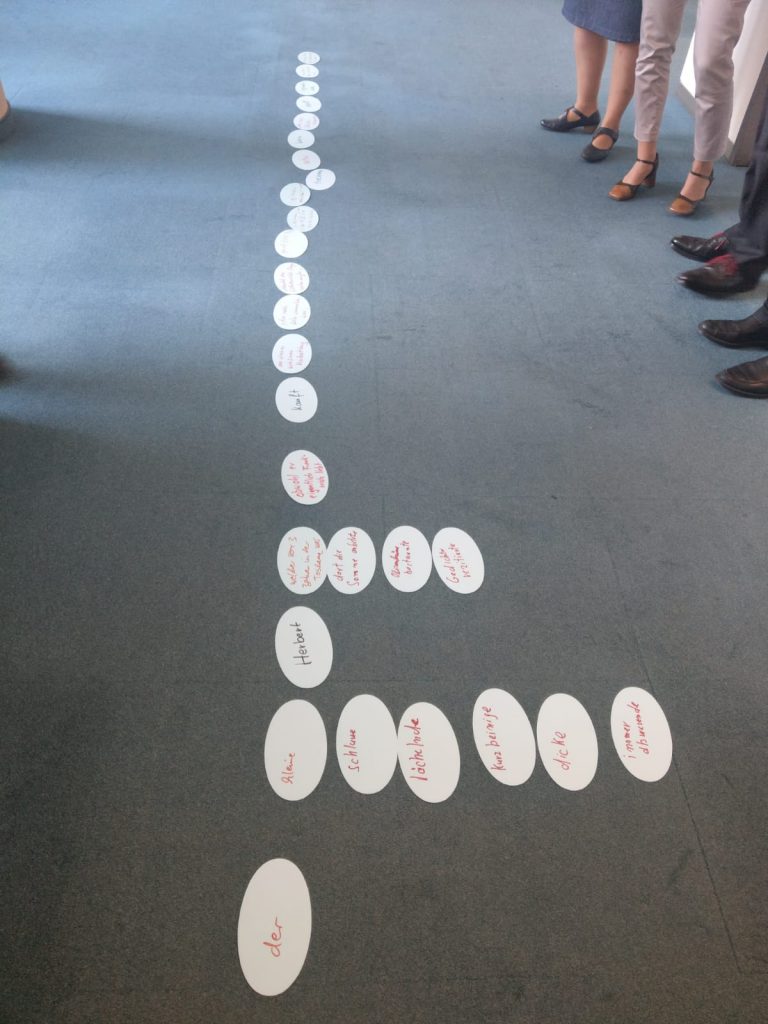

 Wenn erzkonservative christliche
Wenn erzkonservative christliche  Meistens geht es hier um Kommunikation, es kann aber auch mal um einzelne Anwältinnen* gehen, falls es zum Thema meines Buches „111 Gründe, Anwälte zu hassen“ passt. Das ist bei den Plänen, den katholischen Bundestagsabgeordneten und Abtreibungsgegner RA Dr. Stephan Harbath, zum Verfassungsrichter zu machen, der Fall.
Meistens geht es hier um Kommunikation, es kann aber auch mal um einzelne Anwältinnen* gehen, falls es zum Thema meines Buches „111 Gründe, Anwälte zu hassen“ passt. Das ist bei den Plänen, den katholischen Bundestagsabgeordneten und Abtreibungsgegner RA Dr. Stephan Harbath, zum Verfassungsrichter zu machen, der Fall.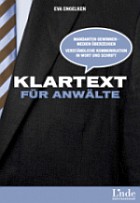 Klartext für Anwälte.
Klartext für Anwälte.