
Wenn man krank ist und eine neue Arztpraxis sucht, ist es ein wichtiges Auswahlkriterium, ob man sich dort gut verstanden und gut beraten fühlt. Das ist bei der Wahl einer Kanzlei nicht anders. Auf die Frage, warum Unternehmer(innen) gerade sie mandatieren sollten, antworten Wirtschaftsanwälte gerne vollmundig: „Weil wir Ihre Sprache sprechen.“
Das mit der Sprache sagt sich so leicht, doch längst nicht immer sprechen Anwalt und Mandant respektive Anwältin und Mandantin die gleiche Sprache. Die eine Seite spricht anwältisch, die andere mandantisch.
Manchmal klingt das sehr ähnlich. Zum Beispiel, wenn der Anwalt ein versierter Berater von Familiy Offices ist, und es sich beim Mandanten um eine vermögende Privatperson handelt, die 8 Millionen Euro auf der hohen Kante hat.
Sie will beispielsweise wissen, wie sie die Kröten inflationssicher anlegen kann, damit ihr Junior, der aktuell nur in seine Windeln große Geschäfte macht, später auf eine Privatuni gehen und dann auch im Wirtschaftsleben große Geschäfte machen kann.
In diesem Fall kann der Anwalt mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ihr Begriffe wie Vermögen, Verwaltung und steueroptimale Strukturierung keine Fremdworte sind, sondern sie weiß, dass es von ihnen abhängt, ob der Junior das Studium mit einem neuen Audio 4 oder mit einem gebrauchten Fiat aufnehmen kann.
Das kann aber auch ganz anders klingen. Es kann zum Beispiel sein, dass der Mandant das Geld nicht geerbt hat und nicht damit aufgewachsen ist, bei Familienfesten mit Geschäftsführern und Honoratioren Small Talk zu machen
Vielleicht ist er ein junger Berufsfußballer mit sogenanntem Migrationshintergrund, der dank seiner herausragenden sportlichen Begabung in die Bundesliga aufgerückt und jetzt Einkommensmillionär ist.
Diese Person, nennen wir sie Kevin, spricht nicht Anwalt, sondern Fußball. Gleichwohl ist er als Mandant hochinteressant. Kevin hat viel Kohle, aber er weiß im Zweifelsfall nicht damit umzugehen. Er kauft lieber den zweiten Lamborghini, statt für die Zeit nach seiner Profizeit zu planen, damit er immer noch Geld hat, auch wenn mit Ende 20 die goldene Quelle Fußball versiegt.
Um ihn gut zu beraten, muss der Anwalt seine Sprache sprechen. Wirft der Anwalt nur Fachbegriffe über seinen wuchtigen Schreibtisch, ist die Person im schlimmsten Fall eingeschüchtert. Also braucht er Übersetzer, die zwischen ihm und Kevin übersetzen.
In jedem Fall sollte sich der Anwalt bzw. die Anwältin die Mandantenbrille aufsetzen und aus Mandantensicht die Fragen beantworten, die immer am Anfang einer guten Kommunikationsstrategie stehen: Welchen Nutzen bietet mir dieser Anwalt? Warum sollte ich gerade ihn beauftragen? Und dann sollte er das Nutzenversprechen in die Wortwelt eines Kevin übersetzen. Dann lautet die Antwort des Mandanten im Idealfall: „Ich habe mich für diese Kanzlei entschieden, denn dort sprechen sie meine Sprache.“

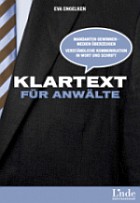 Klartext für Anwälte.
Klartext für Anwälte.