 Ob Menschen ein bestimmtes Verhalten als rechtens empfinden oder nicht, hing noch nie alleine davon ab, ob es gesetzlich erlaubt oder verboten war, sondern von einer gesellschaftlichen Übereinkunft, ob das Verhalten erlaubt oder verboten sein sollte. Diese Übereinkunft ist jedoch brüchig; Interessengruppen, Trends und andere Faktoren beeinflussen sie ständig. Aber auch wir selber können sie beeinflussen: durch unsere Sprache und das durch sie erzeugte Framing unserer Wertvorstellungen.
Ob Menschen ein bestimmtes Verhalten als rechtens empfinden oder nicht, hing noch nie alleine davon ab, ob es gesetzlich erlaubt oder verboten war, sondern von einer gesellschaftlichen Übereinkunft, ob das Verhalten erlaubt oder verboten sein sollte. Diese Übereinkunft ist jedoch brüchig; Interessengruppen, Trends und andere Faktoren beeinflussen sie ständig. Aber auch wir selber können sie beeinflussen: durch unsere Sprache und das durch sie erzeugte Framing unserer Wertvorstellungen.
Das Anliegen meiner Dinner Speech anlässlich des 6. Düsseldorfer Anwaltsessens am 26.11.2018 im Industrie-Club Düsseldorf war es, den Einfluss von Sprache und Frames auf unser Rechtsempfinden zu beleuchten. Dieser Blogbeitrag ist eine weiterentwickelte Fassung davon.

Ein schönes Beispiel für die Macht der Frames sind die Steueranwälte und ihre Steuersparmodelle. Als Organe der Rechtspflege sind sie dem Gemeinwohl verpflichtet. Als Vertreter ihrer Mandanten jedoch deren Interessen. Das führt zu Konflikten, wenn Steueranwälte im Mandanteninteresse „Steuerschlupflöcher“ entdecken, die den Fiskus und damit das Gemeinwesen schädigen. Aktuelles Beispiel sind die Cum-Ex-Aktiendeals, die laut Medienberichten den deutschen Staat um zehn Milliarden Euro erleichtert haben.
Warum dauerte es über zehn Jahre, dass aus dem „Steuersparmodell“ Cum Ex eine schwere Steuerhinterziehung wurde?
Der auch als Dividendenstripping bezeichnete Vorgang war, wie bei allen „Steuersparmodellen“ üblich, zunächst von den Gesetzen gedeckt und wurde später verboten. In der der Zwischenzeit fügte er dem Staat jedoch einen Milliardenschaden zu. Berechtigte Fragen an die Anwälte wären:
- Hätten sie trotz fehlender Verbote von Anfang an einen Unrechtsgehalt in ihrem Tun erkennen müssen?
- Hätten sie angesichts der hohen Summen, um die es ging, gar die Radbruch‘sche Formel analog anwenden müssen? Nach dieser soll sich ein Richter bei einem Konflikt zwischen Gerechtigkeit und gesetztem Recht für die Gerechtigkeit entscheiden, wenn das Gesetz als unerträglich ungerecht anzusehen sei.
Der nunmehr wegen schwerer Steuerhinterziehung angeklagte Erfinder der Cum-Ex-Steuersparmodelle, Rechtsanwalt Dr. Hanno Berger aus Hessen, würde mit Sicherheit für sich in Anspruch nehmen, ein gesetzestreuer Anwalt zu sein, der nur dank seiner Findigkeit mal wieder eine Gesetzeslücke entdeckt und zu Geld gemacht hat.
War nur das Wirtschaftsstrafrecht den Anwälten nicht gewachsen oder gab es weitere Gründe?
Der ehemalige Finanzbeamte könnte vorbringen, dass das heute von der Staatsanwaltschaft behauptete Unrecht vor über zehn Jahren gar nicht erkennbar war. Immerhin dauerte es bis zum Jahr 2012, bis die Cum-Ex ermöglichende Gesetzeslücke geschlossen wurde. Und dann noch einmal fünf Jahre, bis Ende 2017 die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung erhob.
Gewiss ist die Komplexität einer Rechtsfrage ein Argument für ein langes Verfahren. Und Steuerrecht, Wirtschaftsrecht und erst recht Wirtschaftsstrafrecht sind ja wirklich komplex. Der ehemalige BGH-Richter Thomas Fischer schrieb einmal in seiner ZEIT-Kolumne „Fischer im Recht“, dass das Strafrecht dem White-Collar-Crime nicht gewachsen sei. Eine Putzfrau, die fünf Euro stiehlt, ließe sich leichter bestrafen als ein Bankmanager, der 500 Millionen veruntreut.
Das Unrecht eines Cum-Ex-Deals dingfest zu machen, gehört sicherlich in die Kategorie Brainfuck. Alleine die Sachverhaltsaufklärung bei Aktientransaktionen rund um einen Dividendenstichtag brennt WirtschaftsjuristInnen Denkfalten in die Stirn. Hinzu kommt die umstrittene strafrechtliche Bewertung der Cum-Ex-Deals. Ein verfassungsrechtlicher Grundsatz besagt, dass es keine Strafe ohne Gesetz geben darf. Gegenstand des Strafverfahrens dürfte also auch die Frage sein, ob eine zunächst nicht strafbare Handlung überhaupt rückwirkend zu einer Straftat erklärt und bestraft werden darf.
Oder hat ein Framing das „Steuersparen“ zur Notwehr gegen einen gierigen Staat umgedeutet?
Gut möglich, dass es wegen der genannten Faktoren so lange dauerte, bis Gesetzgeber, Staatsanwaltschaft und nicht zuletzt hartnäckige JournalistInnen die Cum-Ex-Deals tatsächlich als Straftaten bezeichneten. Doch auch die eingangs genannte gesellschaftliche Übereinkunft was okay und was nicht okay ist, spielte eine Rolle. Im Hinblick auf die gemeinnützige Pflicht Steuern zu bezahlen, herrscht hier nämlich ein erbitterter Streit.
- Das „Sparen“ von Steuern sei eine notwendige Gegenwehr gegen einen allzu gierigen Staat, lautet das traditionelle Credo der Gesetzeslückenfinder und wird unterstützt von Politikern und Medien.
- „Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt mehr“ lautete hingegen die Botschaft, die etwa der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter Borjans (SPD) mit seinen millionenschweren Ankäufen von CDs mit den Namen potenzieller Steuerhinterziehern zu senden versuchte.
Sprachwissenschaftlerin Wehling: „Frames liefern den Deutungsrahmen für die Wirklichkeit“
Eine Waffe in diesem Kampf ist die eingesetzte Sprache beziehungsweise sind die durch sie aktivierten Frames. Das Framing zählt zu den mächtigsten Wirkmechanismen unserer Sprache. Jedes Wort, das wir hören, aktiviert in unserem Kopf bestimmte Frames, also eine Bedeutung über seinen Wortlaut hinaus.
Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling bezeichnet in dem von ihr verfassten SPIEGEL-Besteller „Politisches Framing“ Frames als „gedankliche Deutungsrahmen, innerhalb derer wir Fakten verarbeiten“. Laut Wehling verleihen Frames Fakten und Begriffen eine Bedeutung, indem sie die Fakten bzw. Begriffe mit unseren körperlichen Erfahrungen und unserem abgespeicherten Wissen über die Welt einordnen.
Als Folge davon sind es nicht die Fakten, die die unsere Einstellung zu Dingen bestimmen, sondern die Frames. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann hat mit dieser Erkenntnis die Annahme vom rational handelnden Nutzenmaximierer erschüttert. In dem gemeinsam mit seinem Forschungspartner Amos Tversky verfassten Werk „Choices, Values, and Frames“ erläuterte er, wie Frames die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen.
Im Hinblick auf die Pflicht Steuern zu zahlen, spielen die in den Medien benutzten Frames den „Steuervermeidern“ in die Hände. Objektiv betrachtet dient die Tätigkeit von Steueranwälten wie Hanno Berger dazu, Konstrukte zu entwickeln, mit denen Mandanten eine eigentlich vom Gesetzgeber beabsichtigte angemessene Besteuerung umgehen können. Die verwendeten Frames erzählen jedoch eine Rechtfertigungsstory.
Storytelling für Steuermilliarden: Flüchtende Mäuse und erquickende Oasen
Ein eindrucksvolles Beispiel von Elisabeth Wehling ist der Begriff Steuerschlupfloch. Er aktiviert den Frame einer Bedrohung, weil das Wort Schlupfloch in uns die Vorstellung einer Bedrohung hervorruft: Bedroht ist eine kleine Maus, die sich mit List dem Zugriff der bösen Katze durch Flucht in ein Schlupfloch entzieht. Somit macht der Begriff Schlupfloch den zu besteuernden Gewinn als Maus begreifbar, die vor der Bedrohung in Form der Besteuerung fliehen möchte. Die eigentlich geschuldete Entrichtung der Steuer wird als Situation vorstellbar, in der man gefangen ist und berechtigterweise ein Schlupfloch sucht.
Dem Schlupfloch stehen weitere Frame-Geschwister zur Seite, etwa das Steuerasyl. Wie der Begriff der politischen Flucht aktivert es semantisch mehrere Rollen:
- Die Rolle der politischen Übermacht wird besetzt von den eigentlich demokratisch erlassenen Steuergesetze, die als Verfolger dem Geld der Reichen und Superreichen etwas Böses wollen.
- Die Rolle des bedrohten wehrlosen Menschen, der fliehen muss, wird wahlweise von den Steuermillionen oder von ihren Eigentümern, den Superreichen, eingenommen. Sie fliehen, um ihr Geld dem übermächtigen Zugriff der Besteuerung zu entziehen.
- Die Rolle des sicheren Asyl, an dem der bedrohte Flüchtling vor Verfolgung sicher ist, das Asyl, wird besetzt von jenen Ländern, die mit ihren Gesetzen die Steuerflucht möglich machen.
Die Verwendung des Fluchtframes und des Asylframes schafft es, in unseren Köpfen aus der gesetzlich vorgeschriebenen Steuer, die dazu dient, öffentliche Aufgaben zu finanzieren, eine Bedrohung grundlegender Menschenrechte zu machen. Aus den Arschlöchern, die ihren Beitrag zum Gemeinwohl verweigern, werden bedrohte wehrlose Geschöpfe, denen man moralisch bedenkenlos Schutz gewähren kann. Ähnliche Mechanismen wirken beim Steuerparadies, wo ja bekanntlich nur die Guten hinkommen.
Deaktivieren kann man sie nur, indem man sie nicht verwendet oder Alternativen anbietet
Wir finden also tatsächlich auf der Ebene der Sprachwirkung einen Ansatz, der erklären kann, warum die Forderung, Steuersparmodellen einen Riegel vorzuschieben, nur schwer Gehör findet. Die gedanklich erweckten Frames sprechen dagegen. Was also wäre die erste Maßnahme, um gegen Steueroasen, Steuersparmodelle oder Steuerflucht wirksam vorzugehen?
Wehlings Rat lautet ganz einfach: Nicht mehr diese Frames benutzen, wenn man über die Vorgänge spricht. Stattdessen sollte man Alternativen suchen, die andere Frames aktivieren. Anstelle des Frames vom ehrlichen Sparer könnte man den Frame eines Betrügers aktivieren, der mit seinem Konstrukt seinen geschuldeten Beitrag zum Gemeinwesen verweigert und damit die Gemeinschaft schädigt.
In dem zuvor erwähnten Kampf um die Bewertung des Steuerzahlens ist tatsächlich eine kleine Verschiebung zu beobachten. So war im Handelsblatt jüngst von den „ergaunerten Steuermillarden“ zu lesen. Der Begriff „Ergaunern“ ruft deutlich andere Vorstellungen wach als etwa die „Steuerflucht“.
Auch Richter und Richterinnen sind beeinflussbar: Tipps für die Kanzleikommunikation
Welche Erkenntnisse sollten Anwälte und Anwältinnen für ihre Kommunikation mitnehmen?
Zum einen die Erkenntnis, dass Frames allgegenwärtig sind. Nur so kann man die Gefahr bannen, die eigene Argumentation mit entgegen wirkenden Frames unwissentlich zu entkräften. Zudem kann man wirkungsvoller kommunizieren. Etwa im Gerichtsprozess. Zwar besagt der Neutralitätsgrundsatz, dass Richter Sine ira et studio, also ohne Zorn und Eifer für die eine oder andere Partei entscheiden sollten. Doch auch Richter und Richterinnen sind der Prägung durch Framing zugänglich. Das erklärt auch, warum Litigation PR solche Wirkung zeigt. Sie setzt Frames ein, um Meinungen zu aktivieren und so den Gerichtsprozess zu beeinflussen.
Frames machen Täter unsichtbar oder ändern ihre Wahrnehmung
Frames können sogar Täter aus dem Blickfeld rücken. 2012 erstach ein Münchner Ehemann seine Frau und die Mutter seiner vier Kinder. Weil ich ihn flüchtig kannte, als Partner einer einer internationalen Wirtschaftskanzlei, verfolgte ich interessiert die Zeitungsartikel, die der Tat folgten und stieß schon damals auf den Begriff von „häuslicher Gewalt“. „Jedes Jahr werden in Deutschland rund 127.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt“ lautet eine beliebige Zeitungsschlagzeile. Fällt Ihnen etwas auf? Der Begriff der häuslichen Gewalt nimmt den Täter aus dem Fokus. Spricht man von häuslicher Gewalt, klingt es, als ginge die Gewalt von prügelnden Häusern aus, aber nicht von Männern. Dabei sind es in 90 Prozent der Fälle sie, die prügeln oder auf andere Weise Frauen verletzen oder eben töten. Korrekt wäre meines Erachtens von „häuslicher Männergewalt“ zu sprechen.
Eine weitere Eigenschaft der Frames: Sie können ändern, wie ein Täter oder eine Täterin wahrgenommen wird. Bezeichnet die BILD-Zeitung einen Straftäter als Raubtier oder Bestie, erweckt sie damit kognitionspsychologisch die Vorstellung, dass man den Straftäter wie ein gefährliches Tier bekämpfen, einfangen, einsperren oder notfalls töten müsse. Als RechtsvertreterIn rutschen Sie prompt in die Rechtfertigungsfalle.
Wirkungsvolle Alternativframes etablieren
Leider hilft es Ihnen überhaupt nichts, einen Frame zu verneinen, also zu sagen: „Nein, mein Mandant ist keine Bestie“, weil auch die Verneinung eines Frames den Frame aktiviert. Selbst wenn Sie zehnmal wiederholen würden: „Nein, mein Mandant ist wirklich keine Bestie“, würden Sie zehnmal den Frame einer wilden Bestie aktivieren.
Was tun? Das einzige, was Ihnen übrigbleibt, ist zu versuchen, einen wirkungsvollen Alternativframe zu aktivieren. Aktivieren Sie für Ihren Mandanten das Bild eines Robin Hood, der für das Gute kämpft. Auf eine interessante Lösung für Thema Kriminalität weist Elisabeth Wehling hin. Danach könne es sich anbieten, die Kriminalität als Virus begreifbar zu machen. „Die Kriminalität greift um sich wie ein Virus.“, oder: „Der Täter stammt aus einer kriminalitätsverseuchten Gegend.“ Die Assoziationskette dahinter lautet, dass man sich mit Strafbarkeit wie mit einem Virus infiziert. Also erweckt der Frame vom Virus in den Lesern oder Zuhörern die Vorstellung, dass die Straftaten eine Krankheit seien, die sich mit besserer Bildung, mit Resozialisierung und gesamtgesellschaftlich mit dem Abbau von Armut behandeln lassen. Das ist doch eine ganz andere Vorstellung als die von abzuknallenden Bestien, oder?
Das Fazit lautet: Frames wirken überall. Ensprechend wird unser Rechts- und Unrechtsempfinden durch unsere Sprache und die mit ihr aktivierten Frames beeinflusst. Mit ein wenig Übung können Sie überall die jeweils wirksamen Frames identifizieren. Das eröffnet Ihnen die Möglichkeit, sie entweder zu nutzen oder sie durch alternative Frames zu ersetzen.
Zur Lektüre:
Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht
2016 224 S.,
ISBN 978-3-86962-208-8, 21,00 EUR
EBOOK (PDF)
ISBN 9783869622095
17,99 EUR bestellen
EBOOK (EPUB)
ISBN 9783869622101
17,99 EUR bestellen
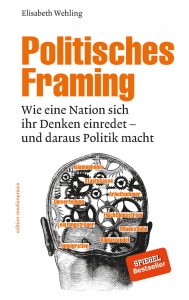
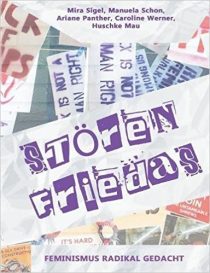
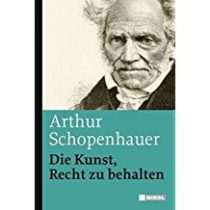
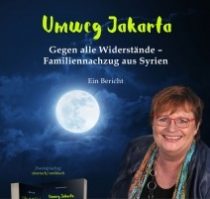


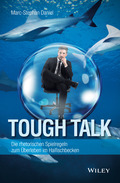

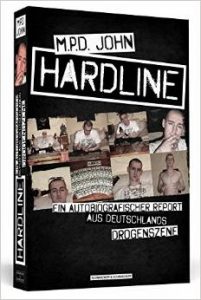

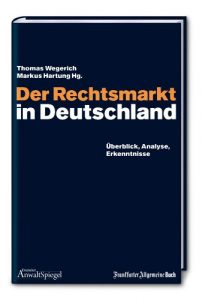
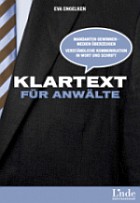 Klartext für Anwälte.
Klartext für Anwälte.