 Erst gestern bemerkte mein geschätzter Journalistenkollege Daniel Schönwitz in seinem Blog, dass das Gendern, also das geschlechtsneutrale Formulieren, allzu leicht dazu führe, dass man passiv wird. Nicht passiv im Sinne von passiv-in-der-Sonne-liegen, sondern passiv durch die Verwendung von Passiv-Konstruktionen.
Erst gestern bemerkte mein geschätzter Journalistenkollege Daniel Schönwitz in seinem Blog, dass das Gendern, also das geschlechtsneutrale Formulieren, allzu leicht dazu führe, dass man passiv wird. Nicht passiv im Sinne von passiv-in-der-Sonne-liegen, sondern passiv durch die Verwendung von Passiv-Konstruktionen.
Ich gab ihm sofort Recht. Gendern ist Mist. Und mir reicht’s damit! Ab sofort werde ich darauf verzichten. Hier in meinem Blog wird es nur noch Rechtsanwältinnen, Bloggerinnen, Besucherinnen und Ratgeberinnen geben. Und Zahnärztinnen und Fußpflegerinnen, sollte ich je über Zähne oder Füße bloggen.
Alle männlichen Angehörigen dieser Berufe dürfen so frei sein, sich mitgemeint zu fühlen. Ab sofort gilt hier folgende Fußnote:
„Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung der männlichen Form verzichtet, Männer sind selbstverständlich mitgemeint.“
Das generische Maskulinum funktioniert im Deutschen nicht. Die Alternative: das generische Femininum
Die Wirkung, dass die männliche Form – die „Rechtsanwälte“ -, als generisches Maskulinum, die weiblichen Angehörigen des Berufs, – also die Rechtsanwältinnen, mitbezeichnet, gibt es in der deutschen Sprache in Wahrheit nicht. Das generische Maskulinum wurde allerdings, und wird noch so benutzt, als würde es die Frauen mitbezeichnen. Und meistens finden sie sich ja auch damit ab, und wenn nicht, kann man immer noch die Floskel schreiben, dass „Frauen mitgemeint“ seien.
Leider weiß die Wissenschaft inzwischen: Wer nur von Rechtsanwälten spricht, tut sich schwer, Frauen, also die Rechtsanwältinnen, mitanzusprechen. Nachzulesen bei der Bloggerin Antje Schrupp. Ich verwende also bis auf weiteres ein generischen Femininum und tue so, als ob man unter Rechtsanwältinnen und Politikerinnen gemeinhin auch die männlichen Rechtsanwälte und männlichen Politiker verstehen würde. Vielmehr: ich erkläre, dass ich sie mitmeine.
Keine Sternchen, Binnen-Is, Unterstriche und Xe mehr
Mitgemeint sind auch alle geschlechtlich Dazwischenliegenden. Ihnen trägt man oft mit einem Sternchen „*“ Rechnung. Etwa in Publikationen der Heinrich-Böll-Stiftung oder in anderen, auf Geschlechtergerechtigkeit Wert legenden Einrichtungen. Hier werden aus „Mitarbeitern“ die „Mitarbeiter*innen“.
Andere, wie zum Beispiel meine geschätzte Netzwerkkollegin Birte Vogel, lehnen das Sternchen ab, unter anderem weil es an den „Judenstern“ der Nazidiktatur erinnert, und setzen einen Unterstrich „_“ ein, um alle Geschlechteridentitäten mitzumeinen. Noch wieder andere verwenden ein „X“.
Hier, in meinem Blog, wird es künftig keine Sternchen, Binnen-Is, Unterstriche und Xe mehr geben. Ich respektiere euer Bedürfnis, sich mit einem anderen Geschlecht zu identifizieren als dem per Geburtsurkunde zugeteilten. Aber hier seid ihr ab sofort mitgemeint. Ihr macht statistisch weniger als 0,1 Prozent der Bevölkerung aus. Wir Frauen machen 51 Prozent aus. Außer in China und Indien, wo man unsern Anteil per Abtreibung weiblicher Föten auf unter 50 Prozent gedrückt hat.
Die Hälfte des Himmels erobert man nicht mit lauen Quoten
Ich bin für Parität, wie sie die Grande Dame der CDU, Professorin Dr. Rita Süßmuth, kürzlich forderte. Frauen steht die Hälfte des Himmels zu. Oder profaner ausgedrückt: sie haben die gleichen Rechte und Pflichten wie Männern. Doch bisher nähern sie sich der Gleichberechtigung derart zaghaft an, als wollten sie den Atlantik überqueren, indem sie mit einem Ruderboot auf einem Baggersee herumpaddeln. Immer freundlich im Kreis herum und bei der ersten Welle zurück ans Ufer.
So wird das nix mit der Hälfte. Auch nicht mit lauen 30-Prozent-Frauenquoten für Vorstände oder Abgeordnete. Wir brauchen eine angemessene Repräsentation von Frauen und Männern. Auf der Führungsebene und darunter: Bei den Erzieherinnen, Altenpflegerinnen oder Soldatinnen. Weg mit der Quote und her mit der Parität!
Das generische Neutrum wäre schön, lässt aber noch auf sich warten
Das generische Neutrum ist das sprachliche Pendant zur Parität zwischen den Geschlechtern. Es wäre schön, wenn wir es hätten, denn die Sprache prägt das Denken und ebnet der faktischen Gleichberechtigung den Weg.
Die englische Sprache besitzt es bereits: „The teacher“, „the chancellor“ und „the minister“ meint jeweils Mann und Frau. In der deutschen Sprache sind generische Neutruum selten zu finden. Die „Majestät“, die „Ihre Majestät, den König“ oder „Ihre Majestät, die Königin“ meint, ist eines der wenigen.
Also müssen wir sie entwickeln. Wir brauchen ein generisches Neutrum und ein generisches Maskulinum, so wie Antje Schrupp erklärt: Eins für Menschen, und eins für Männer. Das Neutrum könnte mit dem Artikel „das“ gebildet werden, und das Maskulinum mit der Endung „ich“, schlägt die Sprachforscherin Luise Pusch vor:
Das Lehrer, die Lehrerin, der Lehrerich.
Die vorläufige Alternative zum Gendern: Nicht mehr gendern, sondern Männer mitmeinen
Bis sich das in unserer deutschen Sprache durchgesetzt hat, hat eine schreibende Frau, die nicht nur mitgemeint sein will, nur zwei Möglichkeiten.
- Entweder sie gendert und verteilt Sternchen & Co, damit Männer UND Frauen und sämtliche Zwischenstufen gleichermaßen angesprochen werden. Natürlich immer möglichst unauffällig oder elegant, damit bloß kein fortschrittsresistenter Macho brüllt „Genderwahn!“ Ich selbst habe redlich versucht, etwa in der Legal Tribune Online, mich für ein elegantes Gendern stark zu machen, das es irgendwie allen ein bisschen rechter macht. Und am Ende kommen trotzdem Irgendwelche und mosern, weil sie immer mosern.
- Oder sie gendert nicht mehr und nimmt behelfsweise die weibliche Form: das generische Femininum.
Ich gehöre dazu. Ich habe genug von der sprachlich korrekten Rund-um-Wohlfühl-Verpackung. Schert euch zum Teufel, ewiggestrige Befindlichkeiten. Ich verzichte auf das Gendern und meine Männer ab sofort mit.
Ich bin sicher, liebe Leserinnen, Sie haben größtes Verständnis dafür!
#fraubellion #frauenland #esreicht
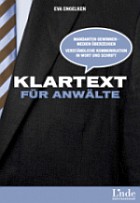 Klartext für Anwälte.
Klartext für Anwälte.