
Menschen, die in Rechtsabteilungen arbeiten, haben es nicht leicht. Sie sollen alles beantworten, was man ihnen hinwirft, sie dürfen keine Vorhaben blockieren, und alles muss gestern fertig sein. Und als wäre das nicht genug, missbrauchen Manche die Rechtsabteilung, um ihre Interessen durchzusetzen. Was hilft, ist eine Kommunikationsstrategie in eigener Sache.
Will Mitarbeiterin X aus Abteilung Y ein Vorhaben verhindern, aber nicht selbst die Buhfrau sein, sagt sie stumpf: „Die Rechtsabteilung hat’s nicht freigegeben.“
Der Rechtsabteilung den schwarzen Peter zuzuschieben, geht ganz einfach. Man muss den Juristinnen einfach nur alle Unterlagen, die sie brauchen, erst in letzter Minute zuschicken. Dann können sie nämlich gar nicht mehr prüfen und müssen die Freigabe verweigern.
Sowas ist gemein. Denn sie würden ja gerne prüfen, wenn man sie ließe.
Zumal sie viel mehr können als nur prüfen. Sie können nicht nur besser lesen und schreiben als ein Großteil der Belegschaft. Sie denken analytisch und können Projekten von vornherein den richtigen Dreh geben. Könnten, wenn sie rechtzeitig dabei wären.
Zuweilen klappt das sogar.
„Frau Meier, Sie haben das hervorragend strukturiert“,
heißt es dann. Aber oft hapert’s . Und die Rechtsabteilung fragt sich: Was kann ich tun, damit die andern mich schneller und besser einbeziehen und mir vertrauen?
Sie könnte einen Leitfaden schreiben. Im schönsten Juristendeutsch
„Um eine verzögerungsfreie Durchführung der Auftragsbearbeitung zu ermöglichen, sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der unternehmensinternen Abteilungen gehalten, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jeweils zu einem frühen Zeitpunkt zu informieren und mit den zur Durchführung notwendigen Informationen auszustatten, ….
Dieser Leitfaden würde vermutlich das Schicksal aller 83 anderen, von der Rechtsabteilung verfassten Leitfäden teilen und in der digitalen Ablage P landen. Was kann sie noch tun? Drohen? Schwierig, schließlich muss sie mit den verängstigen Mitbürgerinnen aus dem Controlling auch noch in Zukunft zusammenarbeiten. Physische Gewalt anwenden? Der Vertrieb geht wesentlich öfter ins Fitnessstudio als die Rechtsabteilung.
Strategisch kommunizieren. In eigener Sache
Was der Rechtsabteilung bleibt, ist, besser zu kommunizieren. Mit einer Kommunikationsstrategie in eigener Sache.
- Ihre erste Herausforderung dabei: Die Anwesenden müssen sich klarmachen, was sie zu bieten haben.
- Ihre zweite Herausforderung: Sie müssen vermitteln, dass es nützt, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Challenge eins: Sind Rechtsabteilungen toll?
Fragt man jemanden in der Rechtsabteilung, ob er toll sei, kann es sein, dass er sagt: „na klar, wir liefern gute Qualität“. Dabei schwingt womöglich etwas Trotz mit, weil man etwas kann, das die Außenwelt aber niemals so wertschätzt, wie sie sollte. Und weil das schon immer so war, dass Juristinnen unter dem Unverständnis und Misstrauen der Welt da draußen litten.
„Oh, Gott, schon wieder dieses Jurageschwafel!“
Erst bimst man sich im Studium die ganzen Paragrafen drauf und wird schier närrisch davon. Man lernt Gutachtenstil und Urteilsstil und begreift unter anderem, dass Juristinnen mit grundsätzlich keinen ehernen Grundsatz meinen, sondern nur, dass halt gerade keine Ausnahme greift.
Im Referendariat oder spätestens im Arbeitsleben kommt der Clash mit der Realität: Man begegnet Menschen ohne Jurastudium und begreift, dass andere es komisch finden, erst mal drei Seiten Text lesen zu müssen, ehe sie erfahren, dass sie einen Widerruf einlegen sollen.
Und aus der Marketingabteilung oder dem Vertrieb heißt es: „naja, ein bisschen weniger Compliance würde doch auch reichen“ oder: „Oh Gott, schon wieder diese Juristinnen“.
Sowas lässt bei einigen einen richtigen Frustknoten im Hirn entstehen. Andere finden sich damit ab, dass man sie nervig findet. Aber niemanden lässt kalt, wenn man ihn seine Arbeit nicht machen lässt.
Dann kommt der Versuch, beide Welten, die Jurawelt und die andere Welt, miteinander zu versöhnen. Man setzt sich die berühmte Mandantenbrille auf und stellt fest: Wir Juristinnen bilden Schachtelsätze und benutzen komische Fremdwörter. Wir kacken Korinthen und unsere Gutachten sind schnell 5, mal 10 oder 100 Seiten lang. Dabei tun wir eigentlich doch Nützliches, aber halt auf Juristenart.
Wir sind nicht langsam, wir arbeiten nur gründlich
Die Lösung des Dilemmas heißt: Erkenne deine Stärken. Der Clou am Juristinnendeutsch und an der ganzen juristischen Arbeit ist nämlich der: Auf der Kehrseite all der endlosen Gutachten und detailüberfrachteten Memos stehen haufenweise positive Eigenschaften.
Für die Kommunikationsstrategie muss man sie nur herausfiltern. Das erreicht man, in dem man die Aussagen übersetzt. Dann wird aus „Ihr braucht immer so lange“ ein „Wir gehen eben in die Tiefe“.
- Aus „Sie sind so kompliziert“: „Wir erfassen komplexe Sachverhalte und wir denken weiter“
- „Sie schreiben endlos lange Verträge“: „Im Ernstfall sind Sie froh über eine Klausel, die Ihren Fall regelt.“
- „Sie sind so pingelig“: „Wir schützen Sie vor strafrechtlicher Verfolgung.“
Und so weiter.
Challenge zwei: Kommuniziere deinen Nutzen
Hat sich die Rechtsabteilung klargemacht, welchen Nutzen sie ihren Mandantinnen bzw. ihren Abteilungen bringt, muss sie ihn kommunizieren. Sie kann sich eine Werbestrategie in eigener Sache ausdenken, um die Abteilungen da draußen zu überzeugen, dass die Rechtsabteilung aus lauter netten und sehr vertrauenswürdigen Menschen besteht. Sie kann sich als interne Dienstleisterin positionieren.
Sie kann die Menschen da draußen zu einem Tässchen Kaffee einladen und sie kann auf ihre Intranetseite schreiben, dass es nicht schadet, die Rechtsabteilung frühzeitig zu beteiligen, und nicht erst in letzter Minute.
Im Idealfall realisieren die da draußen, dass sie mit der Rechtsabteilung eine Anwältin in eigener Sache im Haus haben, die ihnen jederzeit zur Seite steht.
Lerne, überzeugend zu schreiben
Das Gute daran ist: Man kann diese Botschaft „Ich bin deine Anwältin in eigener Sache“ im Idealfall mit jedem Schreiben, das die Abteilung verlässt, vermitteln.
„Im Idealfall“ heißt: Wenn man diesen Nutzen auch formulieren kann. Dazu muss man, siehe oben, die eigenen Fähigkeit verbessern, ohne Schachtelsätze auszukommen. Und man sollte trainieren, besser zu argumentieren, lesbarer zu schreiben, nutzerfreundlicher und so weiter. Kurz, man sollte wirklich mit jedem Schreiben, das die Abteilung verlässt, Service bieten.
Gut ist es, wenn man sich bei dem, was man an Nutzen nach draußen kommuniziert, nicht allzusehr widerspricht. Anders gesagt, es hilft, wenn die Juristinnen, BWLer und anderen Professionen, die in einer Rechtsabteilung arbeiten, an einem Strang ziehen. Sind sie untereinander zerstritten oder kennen sich einfach noch nicht gut genug, hilft Teambuilding. Das kann man buchen.
Nützt das was? Aber sicher!
Und – verhilft all die Anstrengung schließlich dazu, dass Mitarbeiterinnen anderer Abteilungen besser mit der Rechtsabteilung zusammenarbeiten und ihr ihr Vertrauen schenken? Anderen Menschen vorzuschreiben, was sie zu denken haben, ist bekanntlich unmöglich. Und anderen Abteilungen zu sagen, sie sollten der Rechtsabteilung bitte ab sofort ihr Vertrauen schenken, sie toll finden und ihr perfekt zuarbeiten, ist schwierig. Aber möglich. Mit guter Kommunikation.
Und was ist wahrscheinlicher? Dass die Rechtsabteilung mehr wertgeschätzt wird, wenn sie sich darum bemüht, als unentbehrliche Einheit im Unternehmen wahrgenommen zu werden? Oder dass ihr Image besser wird, wenn sie sich einen feuchten Dreck darum schert?
Also, worauf warten Sie noch! Entwickeln Sie Ihre Kommunikationsstrategie in eigener Sache!
Profiunterstützung? Bitte hier entlang.
Bild: Thorben Wengert / pixelio.de
 Wenn erzkonservative christliche
Wenn erzkonservative christliche  Meistens geht es hier um Kommunikation, es kann aber auch mal um einzelne Anwältinnen* gehen, falls es zum Thema meines Buches „111 Gründe, Anwälte zu hassen“ passt. Das ist bei den Plänen, den katholischen Bundestagsabgeordneten und Abtreibungsgegner RA Dr. Stephan Harbath, zum Verfassungsrichter zu machen, der Fall.
Meistens geht es hier um Kommunikation, es kann aber auch mal um einzelne Anwältinnen* gehen, falls es zum Thema meines Buches „111 Gründe, Anwälte zu hassen“ passt. Das ist bei den Plänen, den katholischen Bundestagsabgeordneten und Abtreibungsgegner RA Dr. Stephan Harbath, zum Verfassungsrichter zu machen, der Fall. Ob Menschen ein bestimmtes Verhalten als rechtens empfinden oder nicht, hing noch nie alleine davon ab, ob es gesetzlich erlaubt oder verboten war, sondern von einer gesellschaftlichen Übereinkunft, ob das Verhalten erlaubt oder verboten sein sollte. Diese Übereinkunft ist jedoch brüchig; Interessengruppen, Trends und andere Faktoren beeinflussen sie ständig. Aber auch wir selber können sie beeinflussen: durch unsere Sprache und das durch sie erzeugte Framing unserer Wertvorstellungen.
Ob Menschen ein bestimmtes Verhalten als rechtens empfinden oder nicht, hing noch nie alleine davon ab, ob es gesetzlich erlaubt oder verboten war, sondern von einer gesellschaftlichen Übereinkunft, ob das Verhalten erlaubt oder verboten sein sollte. Diese Übereinkunft ist jedoch brüchig; Interessengruppen, Trends und andere Faktoren beeinflussen sie ständig. Aber auch wir selber können sie beeinflussen: durch unsere Sprache und das durch sie erzeugte Framing unserer Wertvorstellungen.
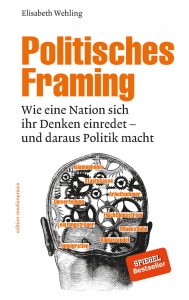






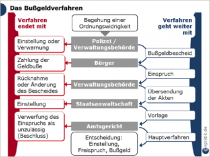
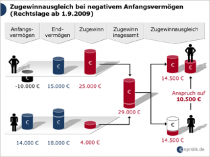
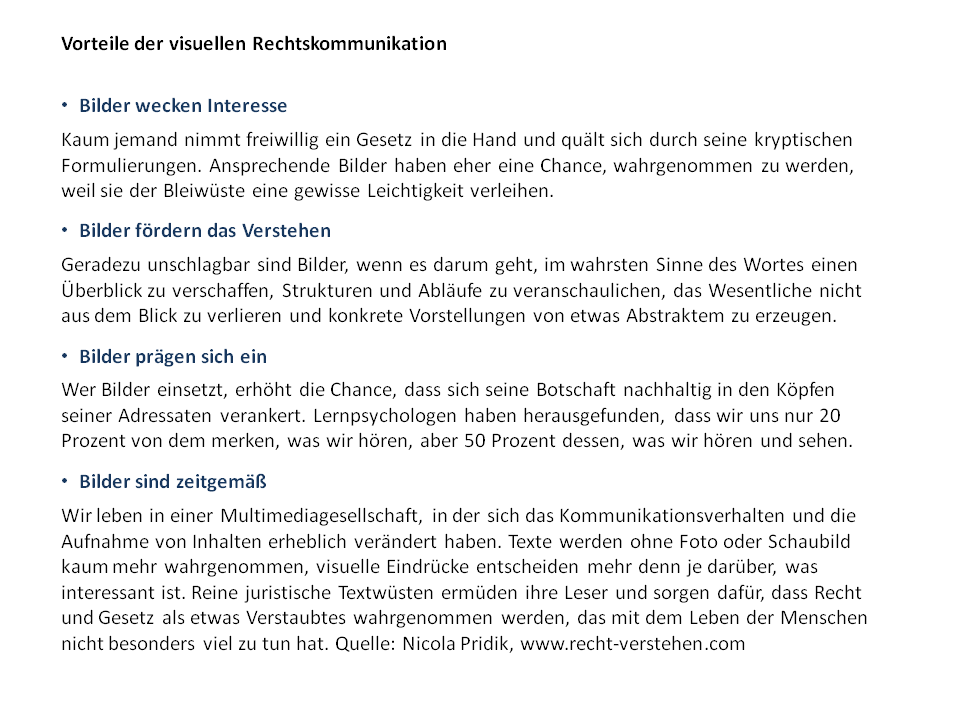
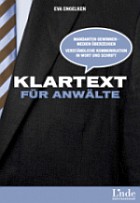 Klartext für Anwälte.
Klartext für Anwälte.