 Ein Titel wie eine Kampfansage: im vergangenen Jahr veröffentlichte der Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag aus Berlin ein mehr als dreihundert Seiten starkes Buch unter dem Titel „111 Gründe, Anwälte zu hassen“. Für die zweite Ausgabe der STUD.Jur. hatte Schriftleiter David Eckner die Gelegenheit, die Autorin kennenzulernen und nur ein paar wenige dieser Gründe zu beleuchten: Eva Engelken studierte Rechtswissenschaften, schrieb als Redakteurin für das Handelsblatt und berät Kanzleien in PR-Angelegenheiten. Eine seltsame Kombination?
Ein Titel wie eine Kampfansage: im vergangenen Jahr veröffentlichte der Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag aus Berlin ein mehr als dreihundert Seiten starkes Buch unter dem Titel „111 Gründe, Anwälte zu hassen“. Für die zweite Ausgabe der STUD.Jur. hatte Schriftleiter David Eckner die Gelegenheit, die Autorin kennenzulernen und nur ein paar wenige dieser Gründe zu beleuchten: Eva Engelken studierte Rechtswissenschaften, schrieb als Redakteurin für das Handelsblatt und berät Kanzleien in PR-Angelegenheiten. Eine seltsame Kombination?
Hier geht’s zum vollständigen Interview als Pdf: beitrag-engelken als Pdf Download
STUD.Jur.: Frau Engelken, wenn man durch die lokale Buchhandlung stöbert, bleibt einem Juristen beim Anblick des in grellem rot erschienenen Einband fast der Atem stocken: „111 Gründe, Anwälte zu hassen“, versehen mit einem Handzeichen, dass erst durch den Profi fußball salonfähig wurde. Wie empfinden Sie diese Reaktion, auch als Mitglied der Zunft?
EE: Es freut mich natürlich, wenn mein Buch Ihnen den Atem raubt. Wobei ich glaube, dass die meisten Juristen und Juristinnen das Handzeichen, das ja auch Peer Steinbrück eingesetzt hat, gut wegstecken können. Schließlich sind Angriff und Verteidigung ihr tägliches Brot. Außerdem erinnert der rote Einband beruhigend an die dicken roten Bücher aus dem C.H.Beck Verlag.
STUD.Jur.: Berichten Sie uns von Ihrer Motivation für das Buch? Was hat sie zur Fertigung des Manuskripts gereizt? Die Praxis, die Ausbildung, das Aufräumen oder Etablieren der Klischees? EE: Ich muss sagen, das Buchschreiben war zum einen Teil Vergnügen und zum anderen Teil Aufräumaktion in meinem Hirn. In all den Jahren, in denen ich mit Juristen und ihren Mitarbeiterinnen zu tun hatte, haben sich so viele skurrile Erlebnisse angesammelt, die wollten einfach mal raus. Und da die Buchreihe „111 Gründe“ heißt, musste ich mir nur die Mühe machen, sie in genau 111 Häppchen und Karikaturen aufzuteilen.
STUD.Jur.: Der Deckel Ihres Buches berichtet uns von zahlreichen Funktionen, die Sie gegenwärtig und in der Vergangenheit ausgeübt haben, wie etwa zu allem Ursprung das Studium der Rechte. Haben Sie das Manuskript gedanklich schon in Ausbildungszeiten begonnen? Wo sehen Sie sich im Übrigen? Haben Sie juristisch praktiziert?
EE: Ich habe in der Tat Jura studiert und beide Staatsexamina abgelegt. Allerdings habe ich mich dann dafür entschieden, meinem Herzen zu folgen und die journalistische Laufb ahn einzuschlagen. Deshalb habe ich ans Referendariat noch eine praxisnahe Ausbildung in der Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten gehängt und dann beim Handelsblatt gearbeitet.
STUD.Jur.: Gibt es einen Archetyp „Jurist“?
EE: Das habe ich versucht zu ergründen, bin mir aber immer noch nicht ganz sicher. Im Märchen gibt es die Helden und Heldinnen auf der einen Seite und auf der Gegenseite die Schurken. Das gibt es auch bei Anwälten, wobei die modernen Wirtschaftsanwälte oft gerne an der Seite derjenigen stehen, die das meiste Geld bezahlen. Das sind nicht immer die Guten. Ein anderer Ansatz ist die Organisationspsychologie. Die teilt Menschen in die 4 Gruppen DISG ein. Das steht für dominant, initiativ, strebsam und gewissenhaft. Anwälte, sagt man, entsprechen am stärksten dem G-Typ, was mich nicht überrascht hat. Ein dritter Ansatz: Kevin Dutton, britischer Psychologe, hat herausgefunden, dass erfolgreiche Anwälte hohe Werte auf der Psychopathenskala erreichen. Das heißt nicht, dass jeder gute Anwalt bzw. Anwältin automatisch psychopathisch ist. Aber es gibt gewisse, markante Eigenschaften, die einen guten Anwalt bzw. eine gute Anwältin ausmachen. Und das sind nicht dieselben Eigenschaften, die einen liebenswürdigen Charakter auszeichnen.
STUD.Jur.: Unsere Leser und Leserinnen sind in der Regel noch keine langjährigen Praktiker, häufig gerade am Start des Übels. Würden Sie Vermeidungstaktiken empfehlen? Manch ein Leser wäre vermutlich bereits beseelt, könnte er nur die Hälfte an Gründen, gehasst zu werde, auf sich vereinen.
EE: Da ist etwas dran. Um Schachtelsätze zu drechseln oder rhetorisch zu glänzen, benötigt man zumindest ein wenig Übung. Vielleicht sogar Begabung. Zwar sagen Rechtsgelehrte wie etwa Uwe Wesel, dass für den Notenerfolg nur Fleiß und keine Intelligenz notwendig sei, aber ich denke doch, dass man für all das abstrakte Denken eine Basisintelligenz braucht. Um eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung im Mehrpersonenverhältnis durchzudenken, hilft diese gewiss.
STUD.Jur.: Das Buch bedient Stereotypen, lässt doch aber jeden Juristen, der auch herzhaft über sich selbst lachen kann, über wahrhaftig Wahres schmunzeln. Wie viel Wahres trifft die fünfundzwanzig Artikel und 111 Gründe Ihres Buches?
EE: Natürlich ist vieles satirisch überzogen, etwa, dass Anwälte beim Fernsehsessel Anschnallgurte empfehlen, aber im Kern ist immer etwas Wahres dran. In diesem Fall, dass Anwälte darauf gedrillt sind, von allen möglichen Ausgängen immer den schlimmsten Fall, den Worst Case, vorherzusehen. Das macht sie einerseits zu nervigen Bedenkenträgern. Andererseits ist es genau diese Eigenschaft, die ihnen zu Gute kommt, wenn sie einen Vertrag aufsetzen, der regelt, wie man bei einem Streit verfährt.
STUD.Jur.: Also sind die Hassensgründe eigentlich gar nicht so hassenswert?
EE: Zumindest sind viele der im Buch persiflierten Eigenschaften ambivalent. Nehmen Sie die anwaltliche Fähigkeit, alles zu definieren, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Wer die Kunst beherrscht, Definitionen zu erfinden und sie bei Bedarf abzuändern, kann sich sprachlich fast aus jeder Klemme winden. Anwaltsgegner finden dieses sprachliche Lavieren höchst hassenswert, für Anwälte und ihre weiblichen Pendants ist es überlebenswichtig. Mir war es wichtig, auf diese Ambivalenz hinzuweisen.
STUD.Jur.: Sie sind in Wahrheit eine Anwaltsversteherin?
EE: Ja, bin ich. Ich verstehe, wie sie ticken und halte ihnen den Spiegel vor. Nach dem Motto: So wirkt ihr nach außen. Sich darüber klar zu werden, wie man auf die Außenwelt wirkt, ist für alle Mitglieder des Berufsstandes nützlich, da sie sich im Gegensatz zu Richtern ja nicht darauf verlassen können, dass die Mandanten zu ihnen kommen. Das heißt aber nicht, dass ich Anwälte, zu denen auch die Anwältinnen zählen, in dem Buch nicht auch kritisiere.
STUD.Jur.: Dann einmal zur Wahrheit: Was werfen Sie Anwälten ernsthaft vor?
EE: Lesen Sie „111 Gründe, Anwälte zu hassen“ (lacht). Nein, im Ernst, ich übe auch Kritik. Teils persönliche Kritik am Verhalten Einzelner, zum Teil übergeordnete Kritik am Berufsstand. Zum Beispiel nehme ich den DAV und die BRAK auf die Schippe, weil sie bis heute keine Reform der Referendarausbildung durchgesetzt haben. Wir haben in Deutschland 164.000 zugelassene Anwälte und Anwältinnen und 20.000 Richter und Richterinnen, dennoch muss jeder junge Mensch, der den Anwaltsberuf ergreifen will, die Befähigung zum Richteramt erwerben, aber keine Anwaltszulassungsprüfung ablegen.
STUD.Jur.: Warum braucht es eine spezielle Anwaltsausbildung?
EE: Weil zum Anwaltsberuf eben noch mehr gehört als das bloße Subsumieren von Fällen. Es gehören Wirtschaftskenntnisse, psychologische Fähigkeiten und vieles mehr dazu. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele große Kanzleien eigene Akademien unterhalten, um den Nachwuchs optimal auszubilden. Als Berufseinsteiger/-in sollte man das berücksichtigen und sich auf jeden Fall eine Kanzlei suchen, die eine gute Aus- und Weiterbildung garantiert.
STUD.Jur.: Dass sie die falsche Ausbildung haben, war Grund Nr. 32. Gibt es weitere ernsthafte Kritikgründe?
EE: Kritik übe ich am Berufsstand auch, weil er die Verfassung und insbesondere die Demokratie nicht entschieden genug verteidigt. Ein Rechtsanwalt ist ja per Gesetz ein unabhängiges Organ der Rechtspflege und genießt als solches bestimmte Berufsprivilegien. Warum? Weil er oder sie den Zugang zum Recht im demokratischen Rechtsstaat ebnen soll. Das erfordert zwingend eine durchsetzungsfähige Berufsaussicht, die streng kontrolliert und gnadenlos denen die Zulassung entzieht, die es mit Demokratie und Unabhängigkeit nicht so genau nehmen. Dazu gehören für mich Anwälte aus der nationalsozialistischen Szene, die selber als Unterstützer in Erscheinung getreten sind. Aber auch Anwälte, die befangen sind, weil sie sowohl als Abgeordnete in Parlamenten sitzen als auch Mandanten mit vielleicht divergierenden Interessen beraten. Wenn die Berufsaufsicht da nicht eingreift und Transparenz fordert und gegebenenfalls die Zulassung zumindest teilweise zum Ruhen bringt, hat sie ihren Namen nicht verdient.
STUD.Jur.: In Grund Nr. 34 spotten Sie, dass Anwälte niemals die Note „sehr gut“ vergeben, aber bei Einstellungen nur auf die guten Noten achten. Wie können sich angehende Juristen darauf einstellen?
EE: Wer selber nach Perfektion strebt, ohne sie je zu erreichen – und das tun Anwälte – gesteht anderen auch keine Perfektion zu, sprich, kann keine 18 Punkte vergeben. Trotzdem gucken Kanzleien bei der Einstellung vor allem auf die Noten. Ich befürchte aber, solange sich die Ausbildung nicht ändert, wird es auch bei der Anbetung der guten Noten bleiben. Anfängern und Anfängerinnen kann ich nur raten: Versucht, ein gutes Examen hinzubekommen, aber verliert nicht den Mut, wenn es nicht hinhaut und lasst euch um Gottes willen nicht einreden, ihr wärt Juristen oder Juristinnen zweiter Klasse. Das ist nicht ganz einfach, denn besonders ältere Richter oder Professoren vermitteln einem gerne diesen Eindruck. Umso mehr empfehle ich jedem Anwalt und jeder Anwältin, sich vom Glauben frei zu machen, nur wer mindestens 9 Punkte hat, könne gut sein.
STUD.Jur.: Es heißt, „als Jurist könne man so ziemlich alles machen“. Neben Ihrer journalistischen Tätigkeit sind Sie unter anderem Texttrainerin für Kanzleien. Was können wir uns darunter vorstellen?
EE: Ich gebe Schreibtrainings für Anwältinnen und Anwälte. Ein Schriftwechsel mit dem Mandanten ist ja nichts anderes als ein schriftlich niedergelegtes Beratungsgespräch. Es muss vermitteln „ich habe dein Anliegen verstanden und ich zeige dir, wie ich dir helfen kann.“ Dafür reicht Fachwissen alleine nicht aus. Es müssen auch psychologisches Geschick und eine entsprechende schriftliche Ausdrucksweise hinzukommen, damit sich der Adressat gut beraten fühlt und gerne die Rechnung bezahlt. Ergänzt wird das durch Körpersprachetrainings. Da arbeite ich mit Schauspiel- und Medientrainern zusammen.
STUD.Jur.: Sind Juristen und Juristinnen denn nicht von Natur aus sprachbegabt?
EE: Ja, viele sind das. Aber auch sie machen sich oft nicht klar, dass ihre Fachsprache eine echte Hürde darstellt. In den 111 Gründen lästere ich, dass Juristendeutsch an Körperverletzung grenzt. Hier trennt sich übrigens die Spreu vom Weizen. Gute Anwälte und Anwältinnen – von Richtern will ich jetzt nicht reden – sind in der Lage, sich höchst verständlich auszudrücken und souverän genug, es auch zu tun. Es sei denn, sie verstecken sich absichtlich hinter Geschwurbel. Die weniger klugen Berufsvertreter haben durchaus schon mal Schwierigkeiten damit, sich verständlich auszudrücken oder sie sind einfach gedankenlos und machen sich nicht klar, welchen Schaden sie mit schwer lesbarem Gelaber anrichten. Die lernen das in den Seminaren aber meist ganz schnell.
STUD.Jur.: Sie sagen also, sich mit der Sprache zu beschäftigen, wäre gut für das Geschäft?
EE: Unbedingt. Sprache ist Werkzeug und Verkaufsargument in einem. Juristinnen und Juristen im Allgemeinen und Anwältinnen und Anwälte im Besonderen müssen in jeder Lebenslage sprachlich überzeugen. Das Gericht, die Mandanten, die Kolleginnen, die Partnerversammlung und daheim den Partner oder die Partnerin. Heißt für Juristen in der Ausbildung: Trainieren, was das Zeug hält. Wenn es die Uni anbietet, schon im Studium.
STUD.Jur.: Neben Ihren Schreibtrainings sind Sie vor allem als PR-Beraterin für Kanzleien tätig. Können Sie uns von diesem Tätigkeitsfeld berichten?
EE: Ich berate Kanzleien bei ihrer internen und externen Kommunikation. Nach außen sind dies die Mandanten, die Medien und die künftigen Mitarbeiter. Nach innen sind dies die Partner und Anwälte untereinander und die sonstigen Mitarbeiter. Als externe Beraterin unterstütze ich die für das Marketing zuständigen Partner. Zunächst geht es immer um die Strategie, also die Frage: Welche unternehmerischen Ziele will ich als Kanzlei oder als einzelne Anwaltspersönlichkeit erreichen? Anschließend um die Umsetzung. Mit welchen Kommunikationsmaßnahmen komme ich dahin?
STUD.Jur.: Was sind denn im Jahr 2015 die gängigen Kommunikationsmaßnahmen der Anwalts-PR?
EE: Im Grund gehört dazu die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation. Vom traditionellen Fachbeitrag über die Pressemitteilung bis hin zum Youtube-Video. Die wichtigste Kommunikationsmaßnahme ist allerdings auch im Jahr 2015 nach wie der Anwalt oder die Anwältin selber. Denn er bzw. sie erbringt höchstpersönlich die zu bewerbende Beratungsleistung und die ist von der Person nicht zu trennen. Anders gesagt, Anwälte verkaufen sich pausenlos selber. Das bedeutet wiederum, dass Anwälte stark an ihrem Marketing arbeiten können, indem sie an sich selber arbeiten und ihre persönlichen Stärken einbringen.
STUD.Jur.: Können Sie das näher ausführen und können das auch schon junge Anwälte?
EE: Unbedingt. Jeder Mensch verfügt über ein individuelles Set an Stärken, Vorlieben und besonderen Fähigkeiten. Eine erfolgreiche Kanzleistrategie setzt auf diese Stärken und nicht darauf, vermeintliche Schwächen zu beseitigen. Nehmen Sie als Beispiel eine junge Anwältin, die überhaupt kein Vergnügen daran findet, in einer Großkanzlei tage- und wochenlang Aktenvermerke zu schreiben. Ihr vorgesetzter Partner findet, das sei notwendig, damit sie sich gut einarbeitet, sie hat aber das Gefühl, in dem Zimmer zu verrotten. Umgekehrt ist sie sehr gut darin, Mandantengespräche zu führen und herauszuhören, wo der Schuh drückt und welche Beratungsleistungen womöglich hilfreich sind. Eine stärkenorientierte Karriereplanung wird das berücksichtigen und ihr ermöglichen, ihr akquisitorisches Potenzial weiter zu entwickeln. Sich hier individuell coachen zu lassen, hilft weiter.
STUD.Jur.: Sind Sie der Ansicht, dass man als PR- Beraterin – so wir den Blick auf potentielle (studienbegleitende) Weiterbildung wenden – geboren oder fortgebildet wird?
EE: Nein, zum PR-Berater oder zur PR-Beraterin wird man nicht geboren, sondern ausgebildet und zwar lebenslang. Public Relations sind die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Zielgruppen; sie mittels geeigneter Kommunikationsstrategien im Interesse des Unternehmens zu beeinflussen, ist Aufgabe der PR-Managerin. Anders gesagt, Public-Relations- Manager und Managerinnen arbeiten mit am Image des Unternehmens. Hierfür gibt es jede Menge Fortbildungen, aber genauso wichtig ist das Learning on the Job und die Bereitschaft, sich mit dem Unternehmen und seinen Bedürfnissen fortzuentwickeln.
STUD.Jur.: Welche Chancen hätten angehende Juristen, diesen Berufsweg einzuschlagen?
EE: Ziemlich gute, denn zahlreiche Eigenschaften, die für eine juristische Tätigkeit nötig sind, helfen auch bei der PR: Biss, Beharrlichkeit, Geschick im Umgang mit Menschen, strategisches Denken, Organisationstalent und gute Schreibe. Eine journalistische Ausbildung zusätzlich zum Jurastudium ist eine gute Ergänzung, denn das schnelle, aber gründliche Zusammenstellen und Auf-den-Punkt-bringen von Fakten ist auch in der Kommunikation gefragt.
STUD.Jur.: Und welche Stellen stehen einem in der PR dann offen?
EE: Sie finden Juristen und Juristinnen nahezu in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation und in allen Branchen. Nicht zwingend, aber naheliegend ist natürlich der Einstieg in der Marketingabteilung einer Kanzlei. Dank des juristischen Hintergrunds versteht man als Berater oder Beraterin das zu verkaufende Produkt Rechtsberatung besser als ein juristischer Laie und kann es gegenüber der Presse und den Mandanten besser verkaufen.
STUD.Jur.: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Anwälte niemanden ernst nehmen, der nicht mindestens ein zweites Staatsexamen hat. Gilt das nicht auch für PR-Berater?
EE: Dass Juristen nur einander ernst nehmen, ist natürlich überspitzt ausgedrückt, hat aber einen wahren Kern. Gerade ältere Anwälte halten Marketing oft noch für eine überflüssige Spielerei, die sie notfalls auch selber erledigen können. Gerade diese älteren Anwälte bringen jedoch Beratern mit juristischem Hintergrund einen ungeheuren Vertrauensvorschuss entgegen. Den müssen sich „normale“ Mitarbeiter erst mühsam verdienen. Je moderner und auch je wirtschaftlicher die jeweilige Kanzleiführung denkt, desto eher ist sie bereit, auch Fachleuten ohne juristischen Background Kompetenz zuzugestehen und Marketingtätigkeiten systematisch an Nichtanwälte zu delegieren.
STUD.Jur.: Spielt bei dem Nicht-delegieren-können vielleicht die Angst vor der Haftung eine Rolle?
EE: Die Angst vor Haftung sitzt einem als Anwalt natürlich immer im Nacken bzw. die Angst vor berufsrechtlichen Verfehlungen oder Klagen der Wettbewerber. Das führt bei vielen zu einer Art Pingeligkeit, die ich in Grund Nr. 22 als „Korinthenkackerbazillus“ verspotte. Der äußert sich in dem fast manischen Bedürfnis, stets und immer Kommafehler korrigieren zu wollen. Und außerdem darin, dass Anwälte selbst unwichtige Kleinigkeiten schlecht aus der Hand geben können. Wenn Sie das nachprüfen wollen, fragen Sie mal in Großkanzleien nach, wie viele hoch bezahlte Partnerstunden jedes Jahr für das Auswählen und Gestalten von Weihnachtskarten draufgehen. Das sind einige.
STUD.Jur.: Nach dem Schreiben des Buches: Würden Sie trotzdem dazu raten, den Anwaltsberuf zu ergreifen?
EE: Unbedingt. Zumal unsere Welt nicht einfacher wird. Man braucht Leute, die einem helfen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook zu verstehen, die sie vorher selber verfasst haben. Oder nehmen sie nur den ganzen Bereich Wirtschaftskriminalität und Compliance. Ohne Anwälte wären Unternehmer aufgeschmissen. Böse Zungen behaupten allerdings, im Bereich Compliance helfen Anwälte, Probleme zu lösen, die es ohne sie nicht gegeben hätte. In jedem Fall bleibt das Fazit, dass Anwälten die Arbeit nicht ausgehen dürfte. Und mir nicht das Material für meine Bücher.
STUD.Jur.: Und das nächste Buch heißt wie? 111 Gründe, Anwälte zu lieben?
EE: Gut möglich, aber das Material dafür zu finden, dauert ein bisschen länger.
Hier geht’s zum vollständigen Interview als Pdf: beitrag-engelken als Pdf Download
Und hier geht’s zum blätterbaren E-Paper auf der Website von Studjur: Und hierhttps://indd.adobe.com/view/1dfc9a5f-f4f8-41d2-bbb6-2c6e00346592?ref=ide



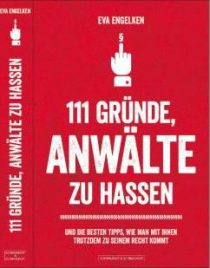
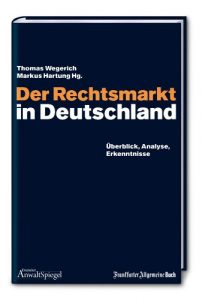

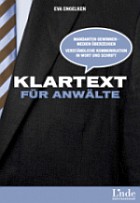 Klartext für Anwälte.
Klartext für Anwälte.