
Hier mein leicht augenzwinkernder und gekürzter Vortrag:
Leadership – geht das mit Anwälten?
Sie haben heute bereits einiges gehört über die Notwendigkeit und über die Möglichkeiten, neue Formen des Managements zu etablieren. Reden wir – kurz vor dem Sektempfang – über die entscheidende Herausforderung dabei: wir müssen diese neuen Formen des Managements in Anwaltskanzleien etablieren. In denen arbeiten bekanntermaßen Anwälte und Anwältinnen. Das führt uns zu der Frage: Modernes Leadership – ist das mit Anwälten möglich? Oder: Mit welchen Eigenschaften qualifizieren sich Anwälte als moderne Leader?
1. Überzeugt ihr optische Außenwirkung?
Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen, heißt ein Sprichwort und das beherzigen auch Wirtschaftsanwälte. Sie sehen top aus. Bei ihnen ist das normale Outfit ein Honorarargument. Erfahrungsgemäß bezahlt der Mandant eine Rechnung über 100.000 Euro bereitwilliger, wenn der Anwalt Budapester Schuhe trug beziehungsweise die Beraterin ein Tuch von Hermès. Das Prinzip dahinter ist die Mimikry. Das ist die optische Angleichung an den Feind, die Insekten oder andere Tiere betreiben. Ungiftige Schlangen ahmen die Muster ihrer giftigeren Artgenossen nach, in der Hoffnung, für einen von ihnen gehalten zu werden. Wirtschaftsanwälte versuchen daher immer, so auszusehen, als seien sie reich und erfolgreich. Der normale Anwalt kündigt lieber das Abo bei C.H. Beck als die Leasingraten für den neuen Porsche. Und sie achten auf Statussymbole: Sattes Brummen unter der Motorhaube, schickes Büro in guter Lage, sexy Sekretärin, Vielfliegerkarte und schicker Titel. Für sie gilt: Mit welchem Namen du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Wer nur Thilo Müller heißt und nicht gerade Bernulph oder Maximilian, muss mindestens einen Doktortitel haben, um in Anwaltskreisen was herzumachen oder einen Adelstitel oder einen LL.M.
Selbst beim Doktortitel sind Anwälte sehr penibel. Kanzleimanager bzw. Managing Partner sollen sich ja immer auf der Wesentliche konzentrieren und Doktortitel sind nun mal etwas ganz Wesentliches. Allerdings ist auch ein schönes und beeindruckendes Äußeres alleine nicht ausreichend für Führungskräfte. Sie müssen auch kommunizieren können. Kommen wir also zur nächsten Frage:
2. Sind sie kommunikativ überzeugend?
Hervorragende Leader sind zugleich hervorragende Kommunikatoren oder Kommunikatorinnen. Egal, ob schriftlich oder mündlich – sie verstehen es, ihr Gegenüber zu erreichen, es zu unterhalten und es zu überzeugen. Das setzt voraus, dass sie sich ihm verständlich machen können. Wie sieht es damit bei Anwälten aus? Man muss die Frage stellen, denn zuweilen kommt es vor – zumindest in der schriftlichen Kommunikation – dass Anwälte da gewissen Herausforderungen unterliegen. Ein anderes Thema ist der althergebrachte autoritäre Führungsstil. Traditionelle autoritäre Führung hieß:
„Los, Sklave, arbeite, bis du umfällst. In Klammer: Und bis ich die Kohle im Sack habe“
Moderne Führung verpackt das subtiler. Bei Google oder Amazon heißt es:
„Wir sind eine Familie. Und wir sind immer für einander da. Und sogar der Frisör ist Tag und Nacht für dich da.“
Die Bedeutung ist dieselbe wie in der autoritären Variante:
„Los, Sklave, arbeite rund um die Uhr, ich sorge nur dafür, dass dir dabei die Haare nicht ins Gesicht hängen.“
Anwälte haben das problemlos verinnerlicht. Im Recruiting/Employer Branding kommunizieren gerade die arbeitsintensiven Großkanzleien gerne voller Stolz, dass ein Kindermädchen bereitstehe, das rund um die Uhr Kinderbetreuung anbietet. Botschaft: Auch hier kannst du bis zum Umfallen schuften. Manchmal können Kanzleien aber nicht mit finanziellen oder geldwerten Anreizen wie Kindermädchen und ähnlichem arbeiten. Hier muss sich nüchternerweise die 3. Frage stellen: Können Anwälte ihre Mitarbeiter durch Lob motivieren?
3. Können sie motivieren?
Hervorragende Leader spornen ihre Mitarbeiter durch Lob an. Sie motivieren sie, vermitteln Sinn und Wertschätzung.Wie sieht das bei Anwälten aus? Aufschlussreich ist ein Blick auf die Anwaltswerdung, also auf die juristische Ausbildung und die beiden juristischen Staatsexamina. Mit den Noten im Staatsexamen ist das ja so eine Sache. Wenn Kanzleien Junganwälte einstellen, wollen sie nur welche haben mit Top-Noten: Prädikat oder gut oder gar sehr gut. Aber wenn sie selber Noten vergeben sollen, als Prüfer im ersten oder zweiten Staatsexamen, sind Juristen und Anwälte extrem knauserig. Die Bestnote »sehr gut« wird nur vergeben, wenn Ostern und Weihnachten zusammenfallen.
Warum bewerten Juristen andere Juristen so schlecht? Weil Jura so schwer ist? Dann müssten die Juristen eigentlich ja auch bei der Einstellung milder sein, aber das sind sie nicht. Oder tun sie sich so schwer mit der Anerkennung der Leistungen, weil ihr persönliches Selbstverständnis es nicht zulässt, andere gütig und milde zu beurteilen? Das führt uns tief in die Anwaltspsyche… Möglicherweise nagen im geheimen an Anwälten tiefste Selbstzweifel, auf den sie nach außen mit Zynismus reagieren…
Solche Selbstablehnung führen Psychologen auf eine traumatisierende Ablehnung in der Kindheit zurück. Traumatisierte Kinder reagieren leicht mit selbstverletzendem Verhalten wie dem Ritzen der Arme oder mit einer exzessiven Lebensweise, Drogen und dergleichen mehr. Damit riskieren sie unbewusst, Schaden zu nehmen. Bei Anwälten äußert sich das subtiler. Nach außen demonstrieren sie stets, dass sie sich selbst für die Krone der Schöpfung halten und die anderen für Schwachköpfe. Für psychologisch geschulten Betrachtern könnte das ein Indiz sein, dass sie in Wahrheit damit von etwaigen Selbstzweifeln ablenken.
Auch die von Dienstleistern oder untergebenen Mitarbeitern oft beklagte Beratungsresistenz ist auf die Selbstablehnung zurückzuführen. Statt nach innen kehren die Anwälte ihre latente Aggressivität und Abwertung nach außen. Das ist natürlich bitter. Denn vielleicht sind auch Anwälte in Wahrheit ganz anders. Tief drinnen sind sie vielleicht zutiefst friedliebend? Vielleicht bemüht sich niemand stärker, Konflikte zu vermeiden als Anwälte? Sind es vielleicht einfach vertrauensselige Gemüter, die in ihren Mitmenschen nur das Gute sehen? Und von den täglichen Enttäuschungen allmählich verbittert sind? Das Fazit lautet: Beachten Sie die traumatisierte Anwaltsseele.Die könnte Ihnen womöglich einen Strich durch die Rechnung macht, wenn es ans Loben geht. Wer keine Anerkennung erfährt, kann auch anderen nur schwer Lob und Anerkennung spenden. Aber man kann ja auch delegieren. Womit wir beim nächsten Punkt unserer Leadership-Merkmale wären:
4. Können Anwälte führen?
Führung heißt, nicht alles selber machen, sondern Verantwortung an die richtigen Personen delegieren. Gute Manager planen ein Projekt, bestimmen Verantwortliche für untergeordnete Bereiche und statten sie mit so viel Verantwortung aus, dass sie ihre Aufgaben eigenmächtig erfüllen können. Nur in wichtigen Punkten mischen sie sich selber ein. Etwa bei den Weihnachtskarten. Hier sind strategisch relevante Fragen zu klären: Soll der Tannenbaum auf die linke oder auf die rechte Seite? Solche wichtigen Entscheidungen kann man nicht der Marketingtusse überlassen, die ja nicht mal ein 2. Staatsexamen, geschweige denn ein Prädikat hat.
Auch bei Kommas oder der Rechtschreibung verzichten Anwälte lieber darauf, Arbeit zu delegieren, weil sie wissen, das kann zur Katastrophe führen. Zum Beispiel bei Verträgen. Da kann ein falsches oder fehlendes Wörtchen, wie zum Beispiel „nicht“, eine Haftung in Millionenhöhe auslösen. Da prüft der Partner lieber noch dreimal nach, ob der Vertrag stimmt. Das führt bei den meisten Anwälten über kurz oder lang zum Korinthenkackerbazillus.Ein Symptom von diesem Bazillus ist die pathologische Kommakorrigierwut. Sobald der Anwaltsblick auf bedrucktes Papier fällt, beginnt er, wie ein Scanner die Zeilen entlang zu rattern. Bei jedem fehlenden Komma macht es »Kling«, und vom Anwaltshirn zuckt ein Blitz zur Hand, die sich zur Tastatur hebt und das Komma einfügt. Es gehört schon viel innere Ruhe dazu, sich in Anwaltsnähe die Gewissheit zu bewahren, dass von einem falsch gesetzten Komma nicht die Welt untergeht. Fazit: Was heißt das für unsere Frage, ob Anwälte gute Leader sind, die Unwichtiges delegieren können? Natürlich, dass Anwälte Unwichtiges delegieren können. Kommafehler sind für Anwälte wichtig. Das führt uns zur 5. Frage:
5. Sind Anwälte visionär?
Leadership heißt ja unter anderem, charismatisch und visionär sein Unternehmen in die Zukunft führen. Das ist mehr als reines Management. Leader organisieren nicht nur, sie tragen das Unternehmen weitsichtig in die Zukunft.Wie ist das bei Anwälten? Anwälte sind dafür gut präpariert. Sie können nämlich in die Zukunft blicken.Sie wissen aber auch, was die Normalsterblichen gern verdrängen: dass die Zukunft böse ist. Und dass von allen möglichen Szenarien immer das Worst-Case-Szenario eintritt. Ein Beispiel-Szenario: Schüttet ein Mitarbeiter Bohnerwachs aufs Parkett, weil er seinen Konkurrenten kurzfristig aus dem Feld ziehen will, wird der Kerl nicht nur ausrutschen, sondern sich den Kopf anschlagen, ins Koma fallen und anschließend mit Querschnittslähmung wieder erwachen und horrende Schadensersatzansprüche geltend machen.
Noch bevor der Mitarbeiter das Fläschchen mit dem Bohnerwachs aufschraubt, sieht der Anwalt das alles vor sich.Wie ein rotes Blinklicht blinken in seinem Kopf die Rechtsfolgen auf: Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Ansprüche auf Schmerzensgeld, Schadenersatz, Rehabilitationskosten, lebenslange Rente und so weiter.Anwälte sind darauf getrimmt, Katastrophen vorherzusehen.Das macht sie für die Entscheider in Politik und Wirtschaft unentbehrlich und den normalen Leuten unheimlich. Fazit: Als Fazit könnte man ziehen: Wenn Sie für Ihre Kanzlei visionäre Ziele entwickeln wollen, also visionäre Höhenflüge anstreben, dann gehen Sie davon aus, dass die Anwälte das durchaus mittragen. Aber berücksichtigen Sie das, was nur Anwaltsaugen sehen: Dass man von weit oben tief runterfallen kann. Das heißt: für die Anwälte legen Sie unbedingt Anschnallgurte bereit!Überleitung: Equipment wie Anschnallgurte und ähnliches führt uns direkt zum nächsten und 6. Kriterium: nämlich zur Frage: Sind Anwälte auch organisationsstark?
6. Sind sie organisationsstark?
Gute Manager haben das Zeit- und Ressourcenmanagement im Griff. Wie ist das bei Anwälten? Anwälte haben keine rosarote Brille vor der Nase, aber in jedem Fall haben sie die Uhr im Blick. Sei es, um die billable Hours nachzuhalten, sei es, um eine Frist einzuhalten. Mit den Fristen ist es so eine Sache. Wenn man sie einhält, bemerkt es keiner und dann klatscht auch keiner Beifall. Das widerspricht dem schon besprochenen anwaltlichen Bedürfnis nach Anerkennung, nach Lob und so weiter. Aufmerksamkeit in Form von Ärger gibt es nur, wenn man die Frist versiebt. Oder wenn man sie unter großem Trara gerade noch einhält. Jawohl, Anwälte können Fristen einhalten. Aber sie reizen sie auch gerne aus. In Kombination mit ihrem hohem Verantwortungsgefühl kann das normale Zeitpläne manchmal crashen.
7. Sind Anwälte mental fokussiert?
Leader sind konzentriert und mitunter kaltblütig und skrupellos.Wie sieht es da bei Anwälten aus?Hier finden wir einen Anwaltskenner nicht überraschenden Befund in der Psychologie. Der Anwaltsberuf gehört zu den psychopathischsten Berufen der Welt. Das hat der bekannte Psychologe aus Oxford Kevin Dutton untersucht. Buchtitel: Psychopathen – was man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann. Es gebe, so Duttons These, auch außerhalb des kriminellen Firmaments Psychopathen, die oft bestens in Berufen wie den folgenden zurechtkommen: Chirurg, Anwalt oder Firmenchef. »Eine psychopathische Strategie kann sich zum Beispiel auch im Sitzungssaal als äußerst nützlich erweisen«, sagte Dutton. Psychopathische Persönlichkeitsmerkmale können Anwälten im Beruf nützen. Dazu betrachten Psychologen die Big Five. Das sind fünf entscheidende Faktoren der Persönlichkeit.
- Offenheit für Erfahrung
- Gewissenhaftigkeit
- Extraversion
- Verträglichkeit
- Neurotizismus
Wer bei Verträglichkeit, wozu Vertrauen, Freimütigkeit und Altruismus zählen, niedrige Werte hat, profitiert, wenn es um erbitterte Auseinandersetzungen etwa vor Gericht oder bei Verhandlungen geht. Dutton spricht von den Siegermerkmalen, wenn er von den Grundprinzipien der Psychopathie spricht. Dies sind: Skrupellosigkeit, Charme, Fokussierung, Mentale Härte, Furchtlosigkeit, Achtsamkeit, Handeln. Diese Merkmale können, richtig dosiert, helfen, berufliche Erfolge zu erzielen. Erfolgreiche Psychopathen und Psychopathinnen, können diese Merkmale einblenden, wenn die Situation es erfordert. Verhandlungsmarathon. Oder vor Gericht. Die gute Nachricht: Erfolgreiche Psychopathen können diese Merkmale wieder ausblenden – wie die Regler an einem Mischpult. Zum Beispiel, wenn sie zu Hause mit ihren Kindern herumtoben oder ihre kranke Mutter pflegen. Oder mit ihren Mitarbeitern sprechen.
Das Fazit lautet: Modernes Leadership mit Anwälten ist eine Herausforderung, denn es sind Anwälte dabei. Modernes Management mit Anwälten ist jedoch möglich, denn sie weisen Eigenschaften auf, die für modernes Leadership erforderlich sind. Anders gesagt, Leadership ist möglich, denn es sind Anwälte dabei!
Vielen Dank!



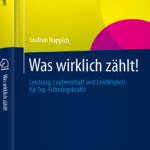
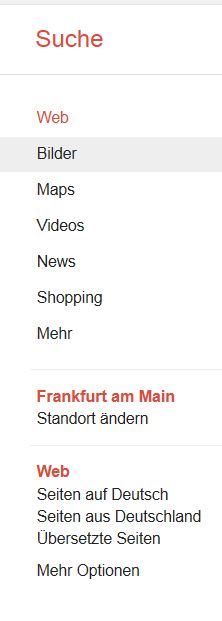
 Interviews sind ein gutes Mittel der Selbstdarstellung
Interviews sind ein gutes Mittel der Selbstdarstellung
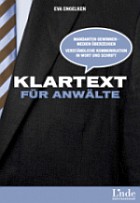 Klartext für Anwälte.
Klartext für Anwälte.