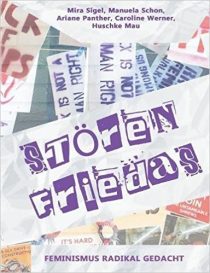 Kaum ein Themenkomplex wird öffentlich derart kontrovers diskutiert, geschmäht, für überflüssig erklärt oder bis aufs Messer verteidigt wie der Feminismus, also die Forderung nach Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und immer wird der Kampf auch um die Deutungshoheit geführt. In Kombination mit dem Schopenhauer-Rhetorik-Klassiker „Die Kunst, Recht zu behalten“ bietet das Buchkapitel „Schopenhauer für Feministinnen oder wie man Antifeministen rhetorisch besiegt“ eine hervorragende Hilfestellung für Diskussionswillige und ein anschauliches Praxisbeispiel zu Schopenhauers doch eher drögen Buch.
Kaum ein Themenkomplex wird öffentlich derart kontrovers diskutiert, geschmäht, für überflüssig erklärt oder bis aufs Messer verteidigt wie der Feminismus, also die Forderung nach Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und immer wird der Kampf auch um die Deutungshoheit geführt. In Kombination mit dem Schopenhauer-Rhetorik-Klassiker „Die Kunst, Recht zu behalten“ bietet das Buchkapitel „Schopenhauer für Feministinnen oder wie man Antifeministen rhetorisch besiegt“ eine hervorragende Hilfestellung für Diskussionswillige und ein anschauliches Praxisbeispiel zu Schopenhauers doch eher drögen Buch.
Argumentationshilfe des Philosophen Arthur Schopenhauer
Das von Mira Sigel verfasste Kapitel findet sich in dem 550 Seiten starken Werk „Störenfriedas – Feminismus radikal gedacht“ für 24,90 Euro. Praxisnah referiert die Autorin darin die Rhetoriktipps des Philosophen Arthur Schopenhauer (*1788, † 1860) und benutzt sie, um zu erläutern, wie man gegen Frauen eingesetzte Sophismen erkennt und entkräftet. Es regt zum Schmunzeln an, dass Sigel ausgerechnet Schopenhauers Tipps für den Feminismus in Stellung bringt, wo sie dem Philosophen doch unterstellt, ein Frauenhasser zu sein.
Sophismen und Scheinargumente anhand von Tweets identifizieren
Noch während der Lektüre bin ich sofort auf Twitter gegangen und habe dort jede Menge Scheinargumente entdeckt. Eine ergiebige Fundgrube war eine längere Diskussion, die entstand, als sich eine Frau beschwerte, dass sich in Diskos fremde Typen ungefragt an ihr reiben würden, das empfinde sie als sexuelle Belästigung.
kerle im club denken sexuelle belästigung ist eine erfindung der gesellschaft und reiben einem beim tanzen ihren ständer in den rücken und packen einen an den arsch aber hey wenn sie einem was zu trinken ausgeben hinterher ist das doch ok oder etwa nicht
— Lena blauer Haken (@leanindersprite) 20. Mai 2018
Dieser Tweet bekam viel Zuspruch, aber auch viel Gegenwind durch Argumente, die sich ohne weiteres den Schopenhauer’schen Sophismen oder Scheinargumenten zuordnen lassen. Einer davon bezog sich auf die aktuelle Klage über die „Weißen Männer“ und den von US-Präsident Donald Trump benutzten Slogan „Make Amerika great again“.
Endlich weißen patriarchalischen Männer verbieten feiern zu gehen. Make Society Great Again!
Ich würde ja ehrlich deinen Versuch hören dieses Problem zu lösen.— Insomnia_Tweets (@NocteTacere) 21. Mai 2018
Mithilfe der Störenfrieda-Lektüre konnte ich diesen Kommentar als sogenanntes Strohmann-Argument identifizieren. Strohmann-Argumente widerlegen Argumente, die ursprünglich gar nicht angeführt wurden. Im Twitter-Beispiel beschwerte sich die Frau ja über unerbetenes sexuelles Berührtwerden in Diskotheken. Zur Debatte stand also ein konkretes Verhalten an einem konkreten Ort. Daraus zu folgern, die Beschwerdeführerin wolle Männern insgesamt und generell das Feiern verbieten, ist eine Unterstellung.
Ob diese Aussage zutrifft oder nicht, ist für den Scheinargumentierer nebensächlich, denn der eigentliche Zweck der Unterstellung liegt darin, geschickt die Aufmerksamkeit von der eigentlich zu führenden Debatte abzuziehen.
Bei rhetorischen Ablenkmanövern stur Ad Rem diskutieren
Strohmann-Argumente justieren den Aufmerksamkeitsscheinwerfer neu und richten den Lichtkegel auf ein anderes Objekt, wodurch das eigentliche Thema in den Schatten gerät. Dieser Effekt wird in dem betreffenden Tweet durch Buzzwords verstärkt: „Weiße patriarchalische Männer“ oder der Slogan „Make Society Great Again“, der den bekannten Trump-Slogan „Make Amerika Great Again“ verfremdet. Beide Buzzwordkombinationen tragen dazu bei, die Debatte auf einen Nebenkriegsschauplatz zu führen. Im Ergebnis ist der gesamte Tweet ein Ablenkmanöver, um die objektiv berechtigten Ausgangsfragen nicht weiter zu thematisieren.
Der einzig wirkungsvolle Konter auf solche Ablenkmanöver besteht darin, stur auf den eigentlichen Debattengegenstand zurückzuführen und sinngemäß zu sagen:
„Lenk nicht ab! Es geht hier um die Frage, ob sich eine Frau in einer Disko sexuell berühren lassen muss. Und warum Männer denken, sie hätten sich das Recht dazu erkauft, wenn sie der Frau einen Drink bezahlt haben.“
Keinesfalls zielführend ist es, das Strohmann-Argument widerlegen zu wollen und sinngemäß zu entgegnen:
„Nein, ich habe überhaupt nichts gegen feiernde Männer, aber…“,
denn schwupps hat man sich auf den Nebenkriegsschauplatz begeben.
Persönliche Angriffe ad personam wirkungsvoll parieren
Auch weitere Twitterkommentare auf den eingangs genannten Beschwerdetweet konnte ich als Scheinargumente identifizieren. Zum Teil gehörten sie in die Kategorie der Tu quoque(=Du auch)-Argumente, einer Untergruppe der Ad personam-Argumente. Beim Tu quoque wird der sich beschwerenden Frau vorgehalten, sie oder irgendeine andere Frau habe doch irgendwann auch schon einmal das betreffende Verhalten gezeigt oder es sogar selber herausgefordert.
Es ist mit nichts zu entschuldigen und ich kann es auch nicht erklären.
Aber umgekehrt verhalten sich einige (betrunkene) Frauen beim „feiern“ nicht anders. Ist also nicht (nur) ein Geschlechterproblem, sondern eher ein (unter Alkohol) Gesellschaftsproblem.— The Real Mr Grey (@marcomeckert) 20. Mai 2018
Das Tu quoque-Argument bezweckt, der Frau als Beschwerdeführerin das Recht abzusprechen, sich zu beschweren. Es lässt sich nur mit dem Hinweis entkräften, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Sinngemäß:
Es geht hier um mich und darum, dass ich von Männern sexuell belästigt werde. Es macht mein Leid durch diese Belästigung nicht weniger schlimm, dass anderswo auch andere belästigt werden.
„Aber die Frau wollte es doch auch!“
Eine perfide Argumentation besteht darin, der Beschwerdeführerin vorzuwerfen, das beschwerende Verhalten selber herausgefordert zu haben. Leider lässt sich diese Argumentation nicht einfach entkräften, denn ihr liegt eine zutiefst fragwürdige Betrachtung von sexualisiertem Verhalten zugrunde. Hier ist das Buch „Störenfriedas“ eine gute Denkanregung, weil solche Argumente unweigerlich kommen und auch in meinem Beispiels-Thread auftauchten.
Der folgende Antworttweet enthält entsprechende Strohmann- und Tu quoque-Argumente und bezweckt eine Abschwächung des Belästigungsvorwurfs durch die Suggestion, dass die Frau die Belästigung ja absichtlich provoziert habe.
Lol, ihr tut hier so als hätte eine frau ihr gutes aussehen oder nen sexy outfit noch nie ausgenutzt… Klar gibt das kerlen keinen grund zu grabschen etc, aber genügend wollen betört oder angehimmelt werden, in kombi mit free drinks…
— M1KKS (@M1onX1) 22. Mai 2018
Problematisch sind diese Argumente, weil sie in Einklang mit einer krass patriarchalischen Grundeinstellung stehen. Der Tweet suggeriert, dass Frauen durch „sexy outfits“ und aufreizendes Verhalten einen Handel anbieten, bei dem der Mann mit ihren Körpern als Gegenleistung für einen Drink nach Belieben verfahren dürfe. Anders gesagt, wenn sich eine Frau mit aufreizendem Verhalten wie eine Prostituierte anbietet, hat das zur Folge, dass sie sich nicht mehr beschweren dürfe, wenn der Mann das Angebot annimmt und mit dem Drink als Bezahlung das Recht einkauft, ihr auf den Hintern zu schlagen oder seinen Penis an ihr zu reiben.
Welches Weltbild steht hinter einer Argumentation?
Die patriarchalische Grundeinstellung blendet aus, dass auch Frauen Lust auf Sexualität und Körperkontakt haben, jedoch selbstverständlich über alle Phasen einer Annäherung hinweg die Hoheit über das Verfahren behalten wollen. Entsprechend muss über den gesamten Fortgang des Verfahrens laufend Konsens zwischen Mann und Frau erzielt werden. Entsprechendes gilt für gleich- oder zwischengeschlechtliche Paare. Jede sexuelle Annäherung ist praktisch eine fortdauernde Bewerbungs- und Verhandlungssituation.
Leider vergiftet die staatlich tolerierte Existenz von Prostitution diese in den Köpfen der Menschen grundsätzlich vorhandene Werbungs- und Verhandlungsbereitschaft, weil sie es „okay“ einstuft, dass sich eine Partei, überwiegend die Männer, das Recht herausnimmt, einseitig den Umfang der Annäherung zu bestimmen.
Die goldene Mitte führt zu faulen Kompromissen
Eng verwandt mit dem Hinweis „Du wolltest es doch auch“, ist das Scheinargument Argumentam ad temparantiam, also der Aufruf zur beiderseitigen Mäßigung.
Er lautet: „Hört auf zu streiten!“ oder: „Lasst uns doch mal alle den Ball flach halten, Frauen werden schließlich auch sexuell übergriffig oder gewalttätig.“
Mit Hinweis auf Schopenhauer warnt Buchautorin Sigel davor, bei Logikfragen derart faule Kompromisse zu schließen. In einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft führe ein beiderseitiges Einlenken nämlich zu keinem Ausgleich zwischen den Geschlechtern, sondern erhalte nur die vorhandene Dysbalance.
Sexuelle Gewalt gehe nun einmal mehrheitlich von Männern aus. Zudem bestehen die von Männern begangenen Taten statistisch in viel schwereren Verletzungen als die Taten von Frauen. Ein Vorschlag, sich doch in der goldenen Mitte zu treffen, weil es ja auch gewalttätige Frauen gebe, verharmlost dieses Problem.
Schönreden, aufbauschen und mit Labeln versehen
Energisch entgegentreten sollten Diskutandinnen auch Euphemismen und Dysphemismen, so Sigel. Diese rhetorischen Tricks basieren darauf, Sachverhalte und Personen zu labeln oder umzubenennen. Negative Sachverhalte werden damit verharmlost.
„Gewalt und Machtverhältnisse verschwinden hinter neutralen bis positiven Bezeichnungen, den Euphemismen“, so Mira Sigel.
Das Gegenteil sind die Dysphemismen, die die damit bezeichnete Person diskreditieren. Sigel nennt als Beispiel den Begriff „Feminazi“, der engagiert für Feminismus eintretende Frauen mit Nazis gleichsetzt und sie damit persönlich abwertet. Wenig überraschend tauchten Dysphemismen auch in meiner untersuchten Twitterdebatte auf.
Tja das sind halt die Mysterien der pseudofeministischen „Logik“. Hirnloses Männer-Bashing ist halt einfacher als sich mit schwerwiegenden gesellschaftlichen Problemen auseinander zu setzen…#MeToo
— Admiral Landwirt (@AdmiralLandwirt) 21. Mai 2018
Mit dem Adjektiv „pseudofeministisch“ und dem in Klammer gesetzten Wort „Logik“, sowie der Unterstellung, dass die nicht näher bezeichneten TwitterautorInnen gehirnlos Männer „bashen“, also schmähen wollten, zog der Twitterautor das angegriffene Verhalten pauschal in den Schmutz. Eine Alternative wäre es gewesen, der Tweetautorin des Ausgangstweets persönlich bestimmte Eigenschaften oder Absichten zu unterstellen („pseudofeministisch“ oder „hirnlos“).
Das wäre ein klassisches Scheinargument Ad hominem gewesen. Mit Ad hominem-Scheinargumenten setzt man ebenso fies wie wirkungsvoll die Glaubwürdigkeit seiner Gegner und Generinnen herab. Ein Beispiel aus der Politik ist Trumps Hillary-Bashing im US-Präsidentschaftswahlkampf mit dem Schlagwort von der „crooked Hillary“, also der gaunerhaften Hillary.
Ad Rem: Zurück zur Sache, Schätzchen!
Der einzige wirkungsvolle Konter auf ein Ad hominem-Argument ist es Sigel zufolge, das Ad hominem-Argument klar zu benennen und auf die Sachebene, Ad rem, zu verweisen. Auf keinen Fall solle man anfangen, so Sigel, sich zu rechtfertigen nach dem Motto „Ich bin aber gar nicht gaunerhaft“. Vielmehr solle man an das Thema erinnern (im oben genannten Tweet die Beschwerde über sexuell übergriffige Männer in der Disko) und zu Argumenten dazu auffordern.
Fazit zu den Störenfriedas
„Schopenhauer für Feministinnen oder wie man Antifeministen rhetorisch besiegt“ ist ein lesenswertes Buchkapitel aus einem ebensolchen Buch, auf dessen Inhalte ich hier sicherlich noch öfter Bezug nehmen werde.
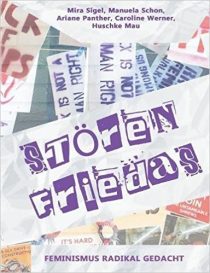 Störenfriedas: Feminismus radikal gedacht
Störenfriedas: Feminismus radikal gedacht
Books on Demand (2018), Deutsch, Kartoniert
ISBN 9783746018515
Osiander: https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=LBRA32375202&source=UWK
Amazon: https://www.amazon.de/St%C3%B6renfriedas-Feminismus-radikal-Huschke-Mau/dp/374601851X
Mehr Infos unter https://diestoerenfriedas.de/
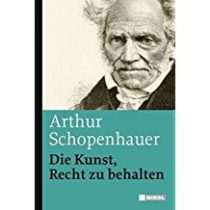 Die Kunst, Recht zu behalten
Die Kunst, Recht zu behalten
Arthur Schopenhauer
Die Kunst, Recht zu behalten
Nikol Verlag (2009), Deutsch, Hardcover
ISBN 9783868200270
https://www.osiander.de/webdb/index.cfm?osiaction=details&id=KNO2009040600059&source=UWK


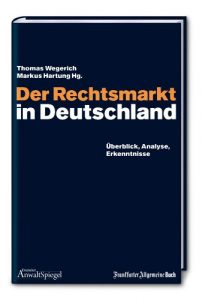
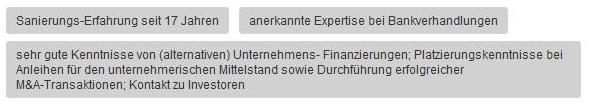
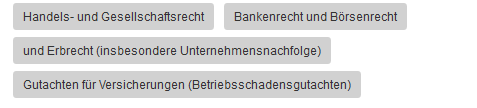

 Natürlich hört man Lob lieber als Kritik und Lästerein. Aber Lobhudeleinen alleine sind auch nix wert, wie schon die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff wusste. Sie schrieb:
Natürlich hört man Lob lieber als Kritik und Lästerein. Aber Lobhudeleinen alleine sind auch nix wert, wie schon die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff wusste. Sie schrieb: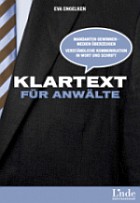 Klartext für Anwälte.
Klartext für Anwälte.