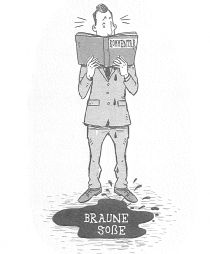 [one-fourth-first][/one-fourth-first][one-fourth][/one-fourth][one-fourth][/one-fourth][one-fourth][/one-fourth][one-fourth-first][/one-fourth-first][one-fourth][/one-fourth][one-fourth][/one-fourth][one-fourth][/one-fourth]Im Polen gelang es vor wenigen Wochen knapp, eine Initiative abzuwehren, die das ohnehin strenge polnische Abtreibungsrecht praktisch in ein völliges Abtreibungsverbot verwandelt hätte. Davon ist das deutsche Recht mit seiner Beratungslösung ziemlich weit entfernt, doch eine konservative Strömung namens „Lebensschutzbewegung“ bemüht sich auch hierzulande um eine immer stärkere Ächtung von Abtreibungen. Man könnte die selbsternannten „Lebensschützer“ als Spinner belächeln, hätten sie nicht kommunikativ kompetente Fürsprecher aus Kirche, Adel, Ärzteschaft – und Rechtswissenschaft hinter sich. Die Dachorganisationen ist der Bundesverband Lebensrecht, der jährlich den sogenannten Marsch für das Leben organisiert. Die Juristen organisieren sich in der 1984 gegründeten Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. in Köln.
[one-fourth-first][/one-fourth-first][one-fourth][/one-fourth][one-fourth][/one-fourth][one-fourth][/one-fourth][one-fourth-first][/one-fourth-first][one-fourth][/one-fourth][one-fourth][/one-fourth][one-fourth][/one-fourth]Im Polen gelang es vor wenigen Wochen knapp, eine Initiative abzuwehren, die das ohnehin strenge polnische Abtreibungsrecht praktisch in ein völliges Abtreibungsverbot verwandelt hätte. Davon ist das deutsche Recht mit seiner Beratungslösung ziemlich weit entfernt, doch eine konservative Strömung namens „Lebensschutzbewegung“ bemüht sich auch hierzulande um eine immer stärkere Ächtung von Abtreibungen. Man könnte die selbsternannten „Lebensschützer“ als Spinner belächeln, hätten sie nicht kommunikativ kompetente Fürsprecher aus Kirche, Adel, Ärzteschaft – und Rechtswissenschaft hinter sich. Die Dachorganisationen ist der Bundesverband Lebensrecht, der jährlich den sogenannten Marsch für das Leben organisiert. Die Juristen organisieren sich in der 1984 gegründeten Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. in Köln.
Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. : Das konservative Who is Who der deutschen Rechtswissenschaft
Man könnte den Kölner Verein als verstaubte Männerrunde vernachlässigen, läsen sich ihre Namen nicht wie das Who is Who der deutschen Rechtswissenschaft und prägten sie nicht seit Jahrzehnten Rechtsetzung, Rechtsprechung und einflussreiche Kommentare. Nun muss man angesichts des hohen Alters einiger Beteiligter allmählich fast schon von einem Who was Who sprechen. Zwei der Gründungsmitglieder, die Juraprofessoren Karl Lackner und Adolf Laufs, starben 2011 bzw. 2014. Die zwei noch lebenden Gründer, Professor Dr. Wolfgang Rüfner und Prof. Dr. Herbert Tröndle, gehen auf die 90 bzw. 100 zu. Auch etliche weitere Herausgeber der vereinseigenen Zeitschrift „Lebensrecht“ sind hoch in den Siebzigern. Geht es also um eine Rollatorfraktion, die sich in Kürze durch Zeitablauf erledigen wird? Das anzunehmen wäre leichtsinnig. Das Gedankengut der juristischen Lebensschützer hat sich der öffentlichen Meinung bemächtigt und junge Juraprofessoren stehen bereit, es weiter zu tragen. Die Wurzeln der Juristen-Vereinigung Lebensrecht reichen bis ins Dritte Reich zurück, aktuelle Verbindungen bestehen zur katholischen Kirche, zum Adel und zur politischen Rechten. Das macht sie zu einer Gefahr für eine liberale, demokratische und gleichberechtigte Gesellschaft.
Die juristischen Argumente der Lebensschützer und ihre eigentlichen Ziele
Die Lebensschützer lehnen die Abtreibung und das geltende Abtreibungsrecht ab. Fast 100 Prozent aller in Deutschland gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche erfolgten aufgrund der Beratungsregelung. Von insgesamt 99.237 Abtreibungen 2015 in Deutschland waren 95.338 straffrei nach der Beratungsregelung in § 218 a Absatz 1 Strafgesetzbuch:
„Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, daß sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen.“
Die restlichen vier Prozent der Schwangerschaftsabbrüche erfolgten aufgrund einer medizinischen Indikation (3879 Abbrüche 2015) oder aufgrund einer kriminologischen Indikation (20 Abtreibungen 2015). Hier liegt zwar der Tatbestand der strafbaren Abtreibung vor, die Indikation beseitigt jedoch die Rechtswidrigkeit. Vom Ergebnis läuft es für die schwangere Frau auf das Gleiche hinaus.
Bundesverfassungsgericht, ja, aber!
Vordergründig argumentieren die „Lebensschützer“ mit dem Schutz des Lebens des „ungeborenen Kindes“. Kommunikativ propagieren sie damit ein unterstützenswertes Ziel: Welcher verantwortungsvolle Mensch wäre nicht bereit, etwas so Niedlichem und Schutzlosen wie einen Baby – oder gar einem ungeborenen Baby – Schutz zuzusprechen? Doch wenn man genauer hinschaut, entdeckt man eine perfide Einseitigkeit in der Argumentation. Den juristischen Lebensschützer geht es darum, das „ungeborene Leben der Verfügungsgewalt der Schwangeren zu entziehen“. Juristisch ist es das Ziel, „dem Grundrechtsschutz des ungeborenen Lebens den Vorrang gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht der Frau zu sichern“. Es ginge nicht an, so Strafrechtskommentator Herbert Tröndle, das „Leben des ungeborenen Kindes allein in die Verfügungsgewalt der Schwangeren zu stellen.“ Embryo gegen Schwangere. Kind gegen Frau. [Weiterlesen…]





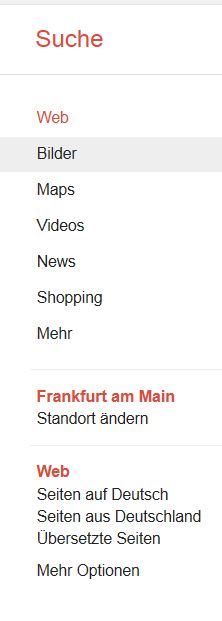
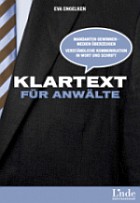 Klartext für Anwälte.
Klartext für Anwälte.